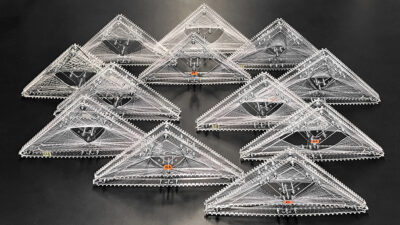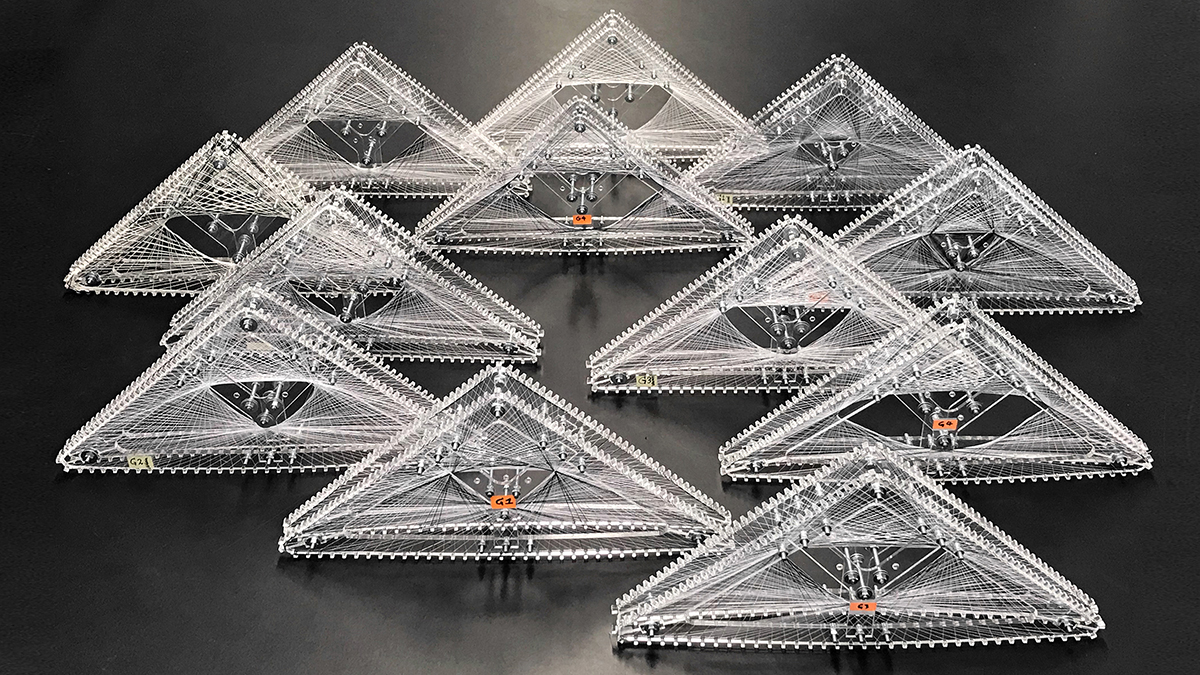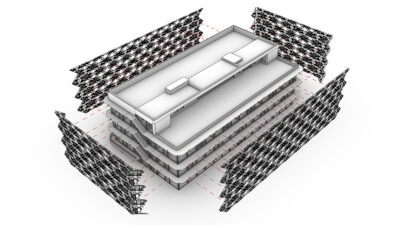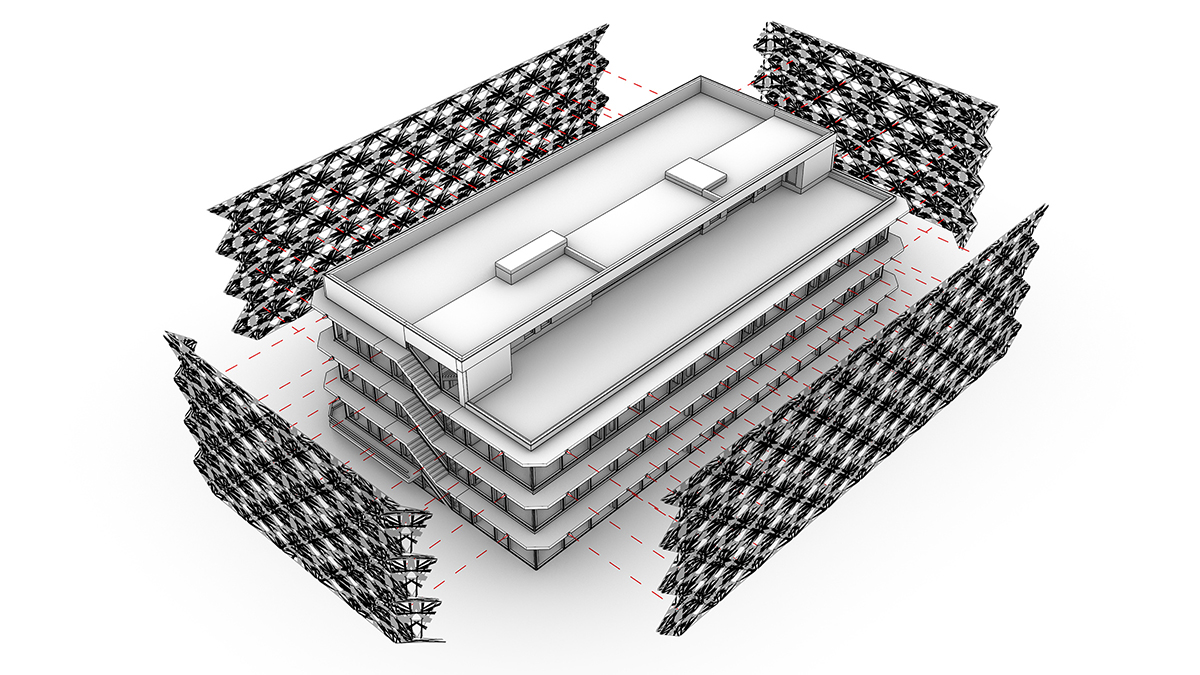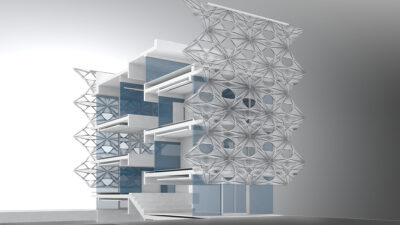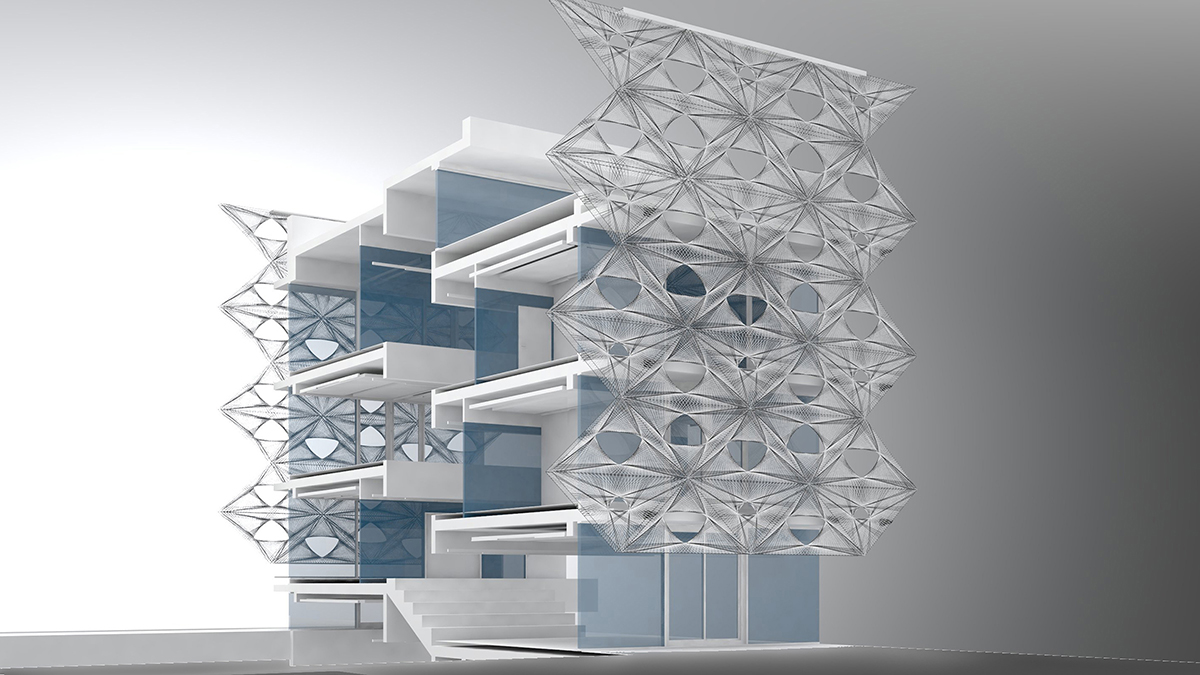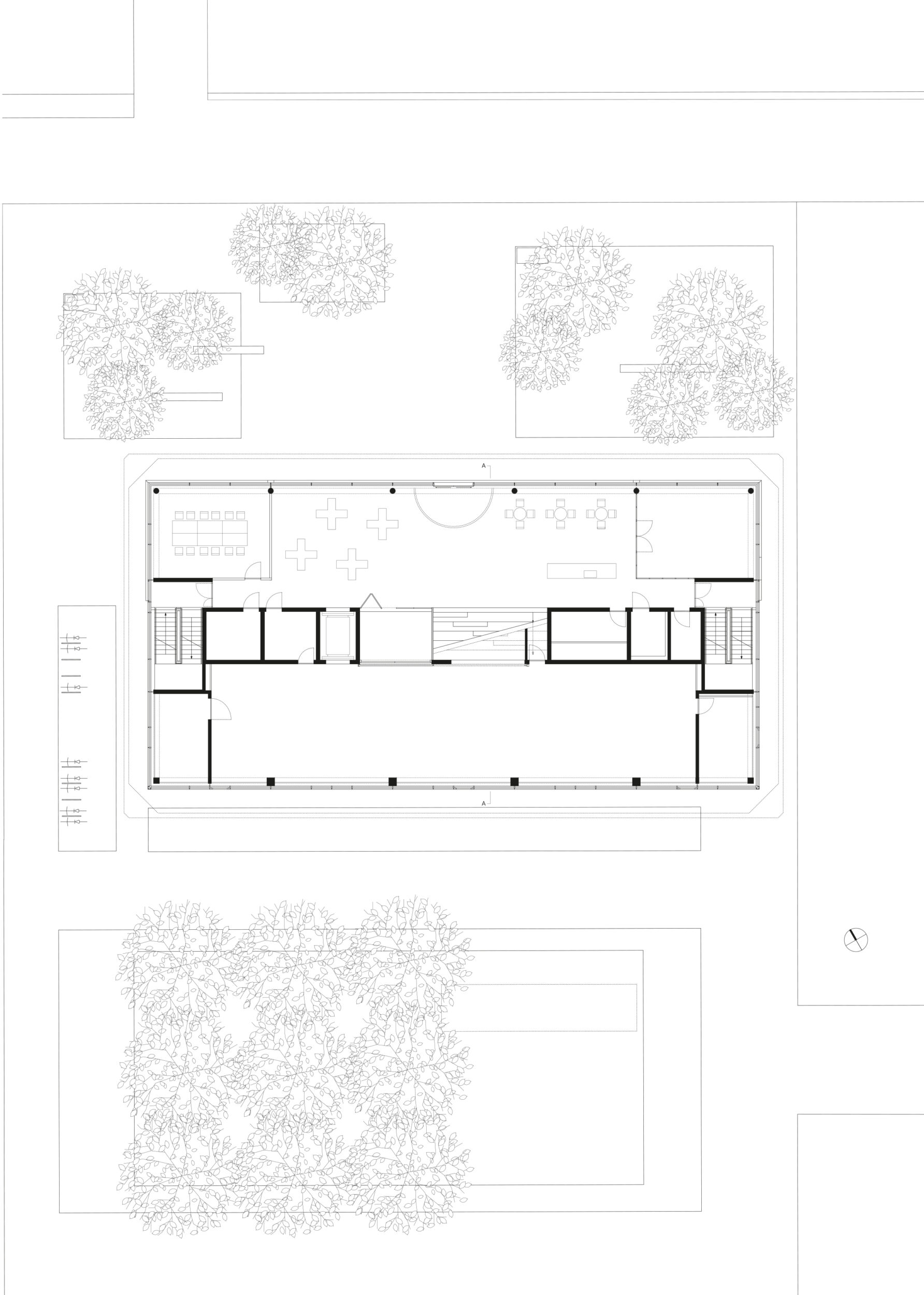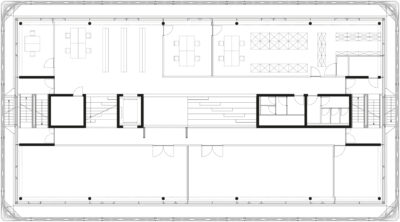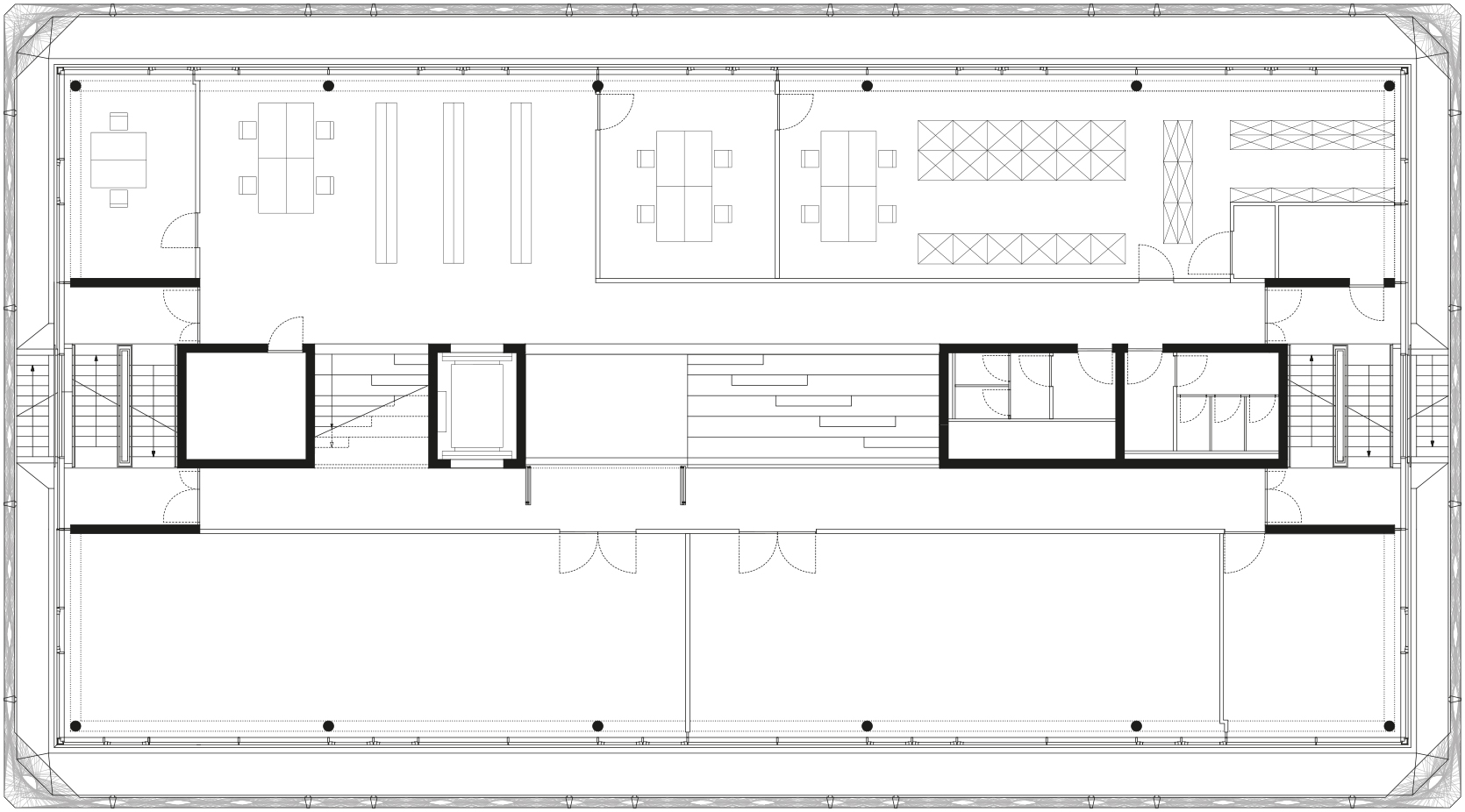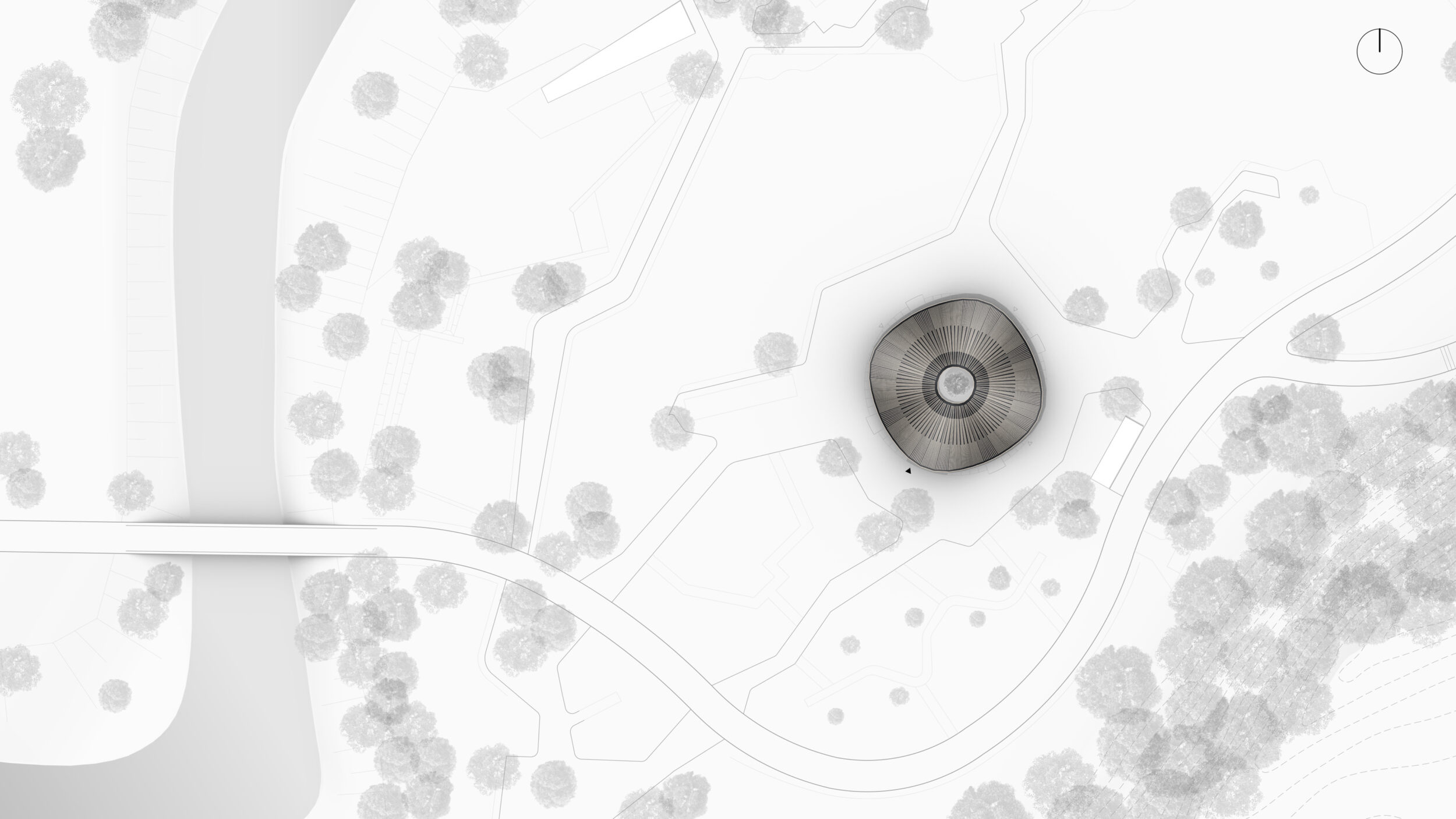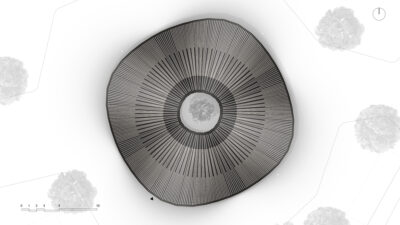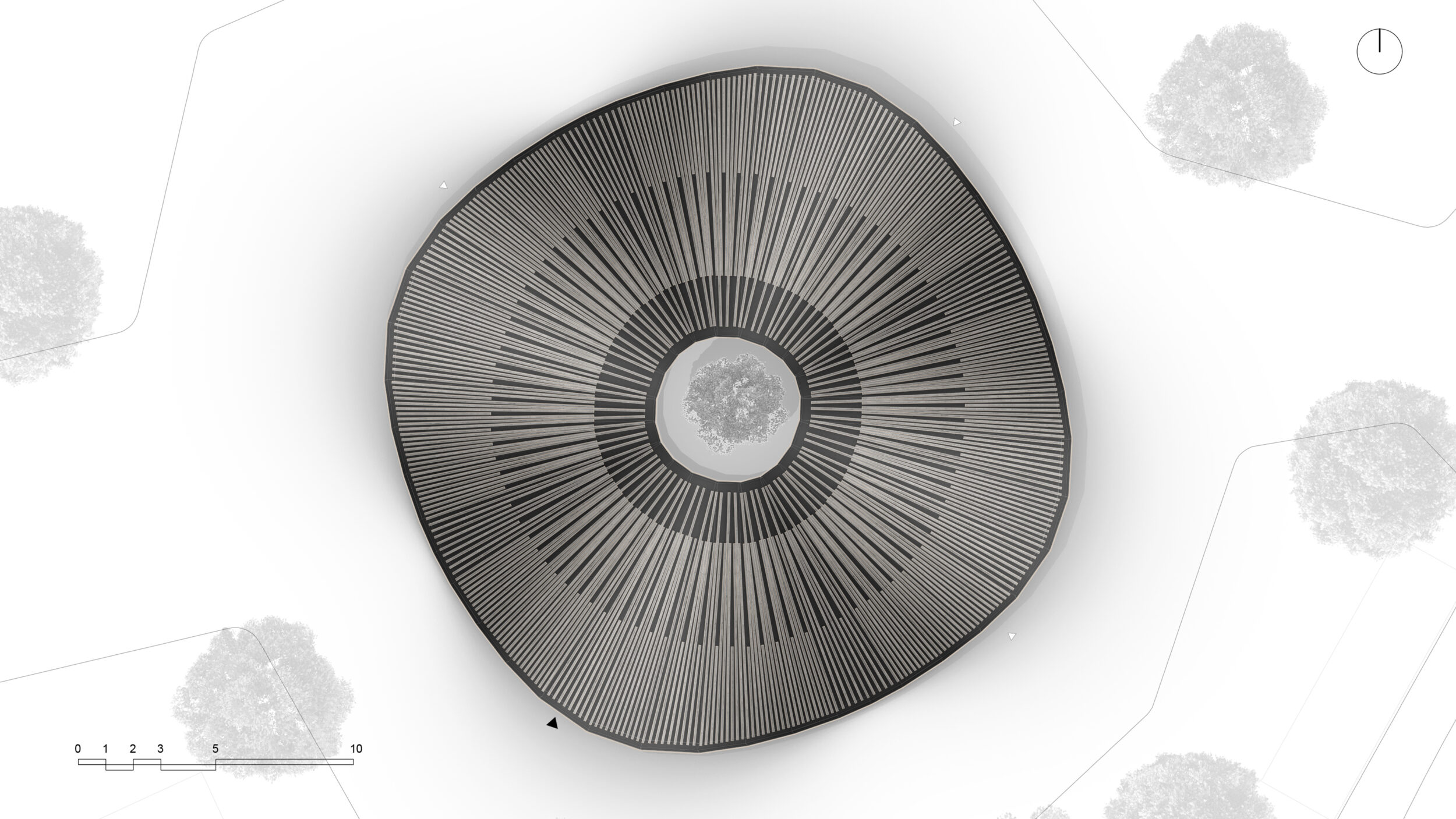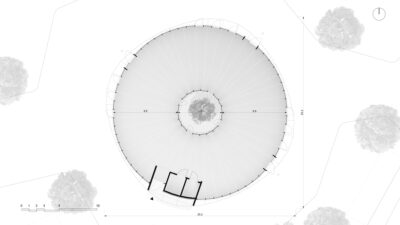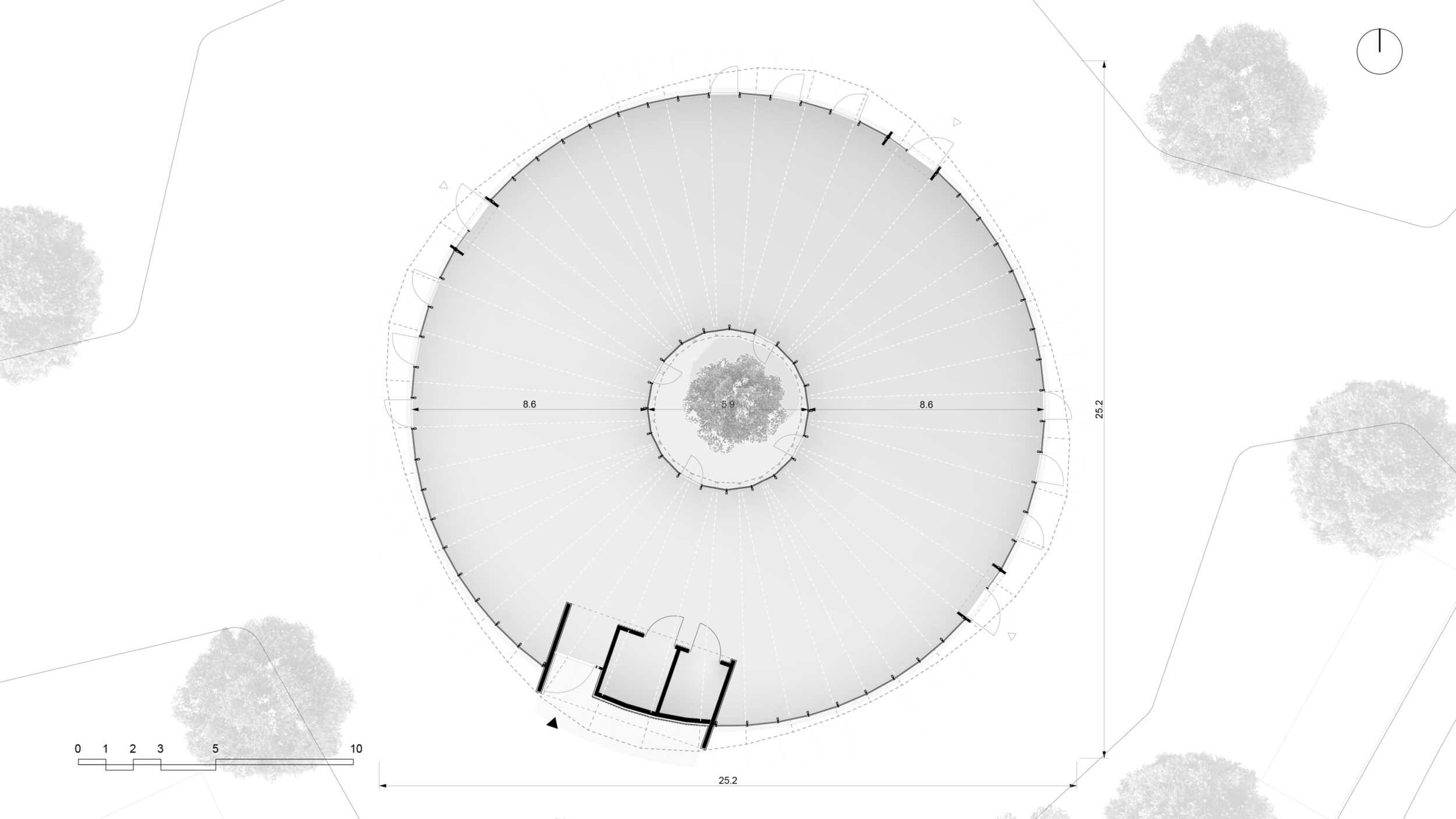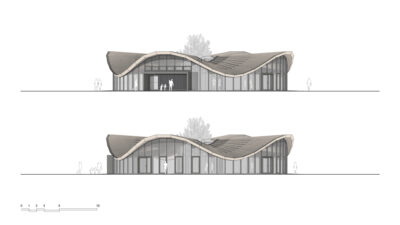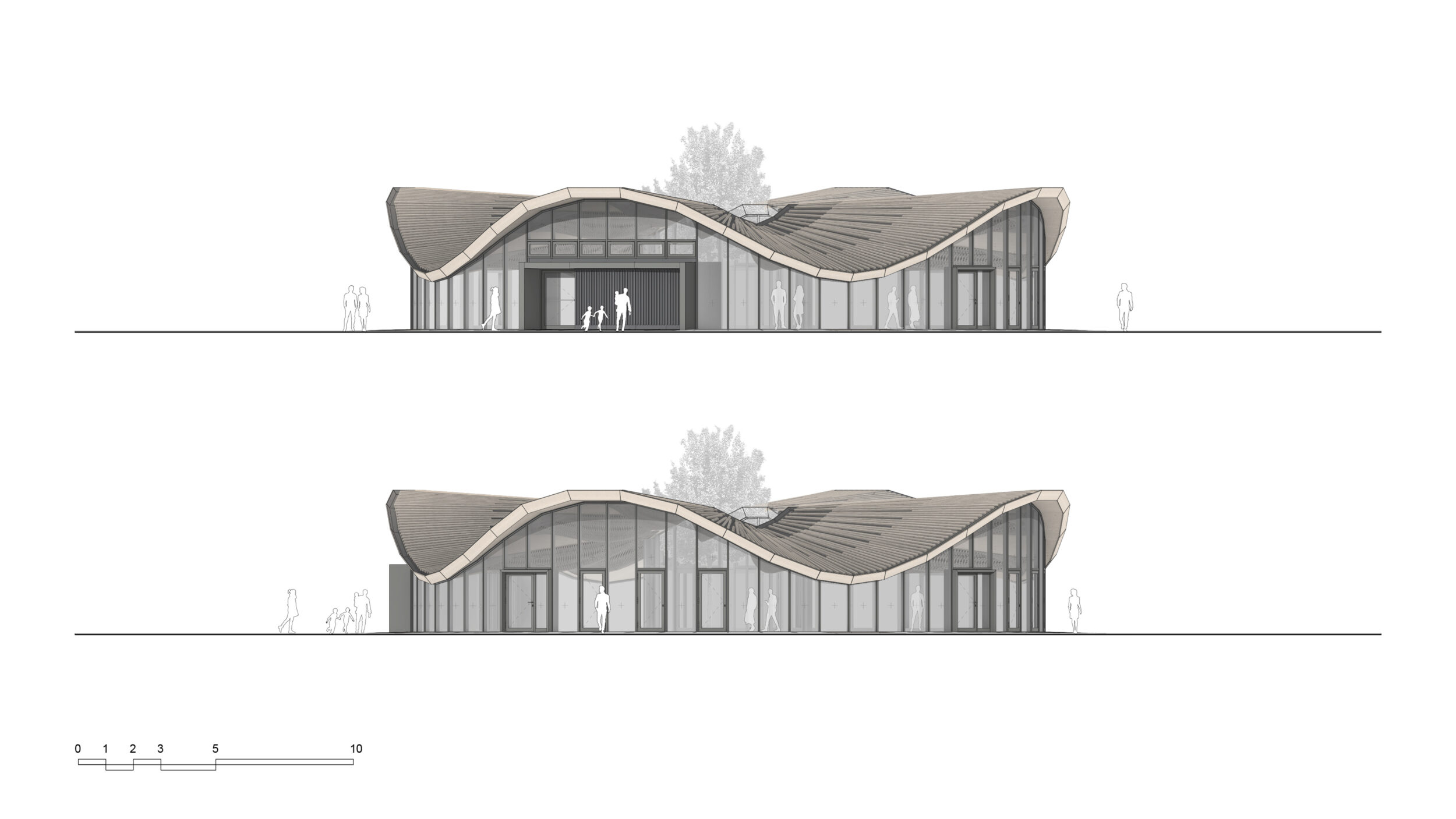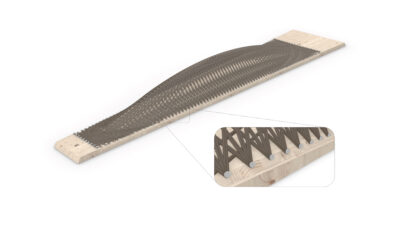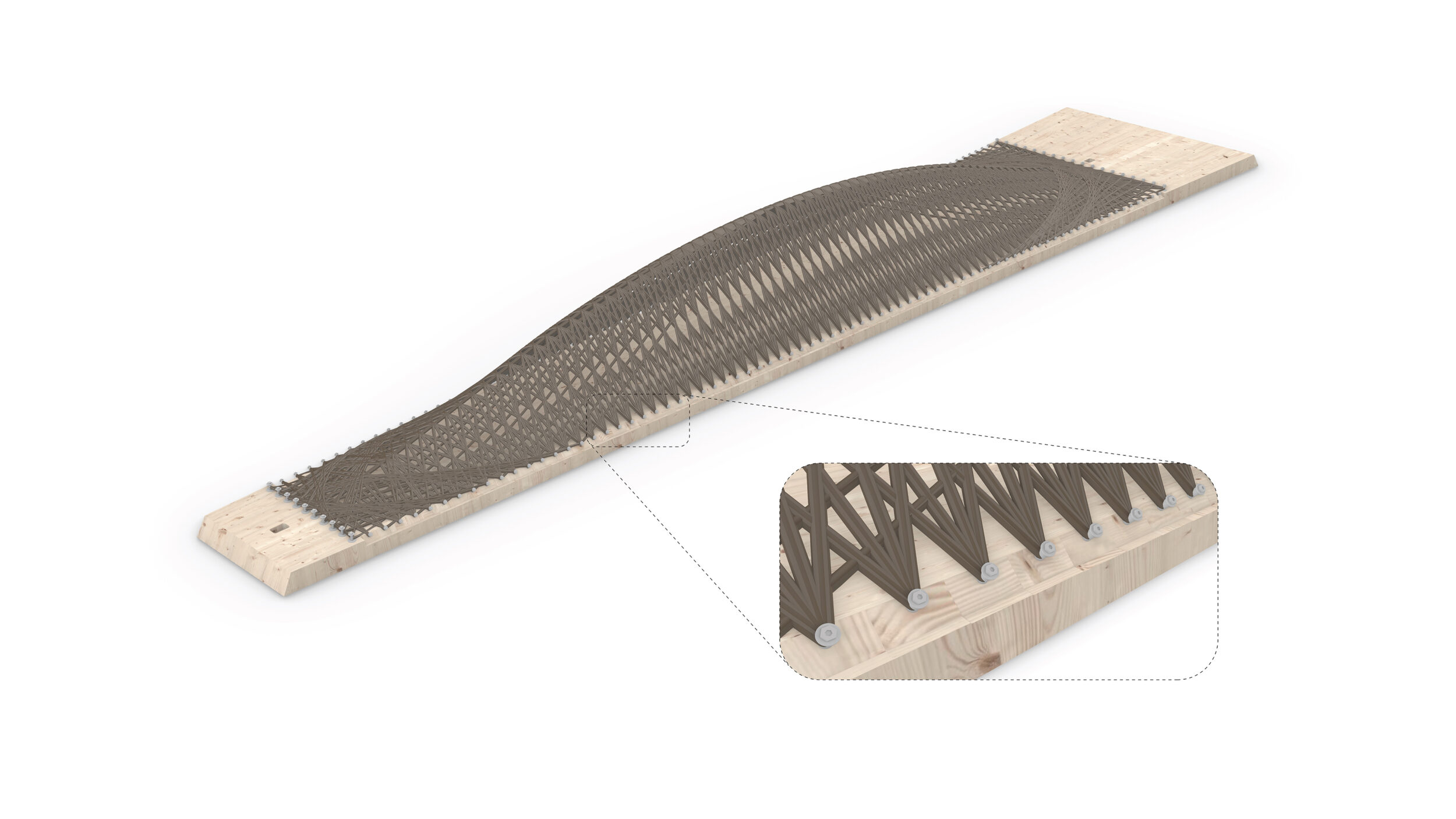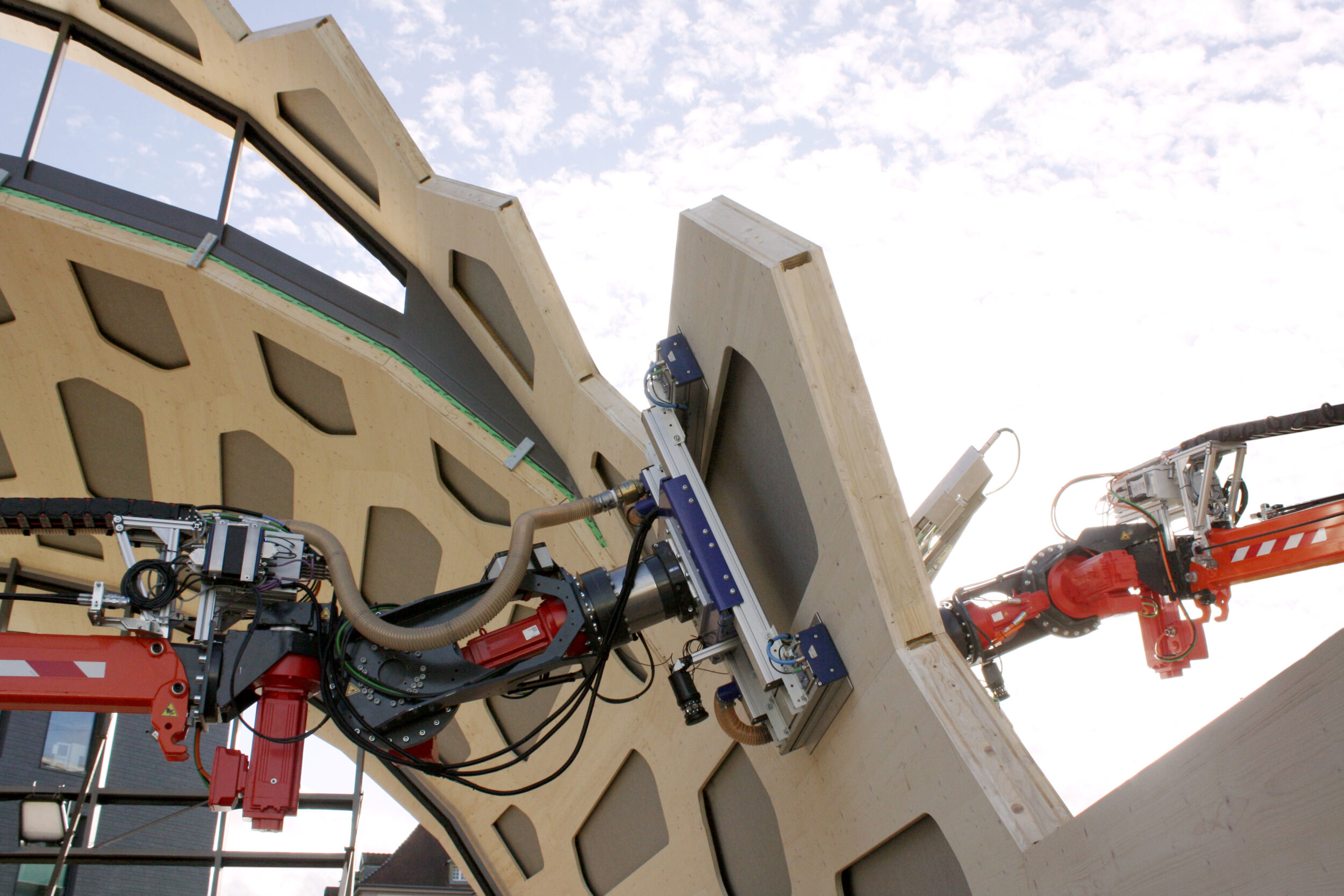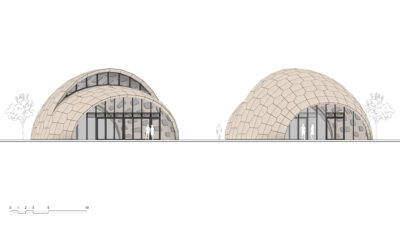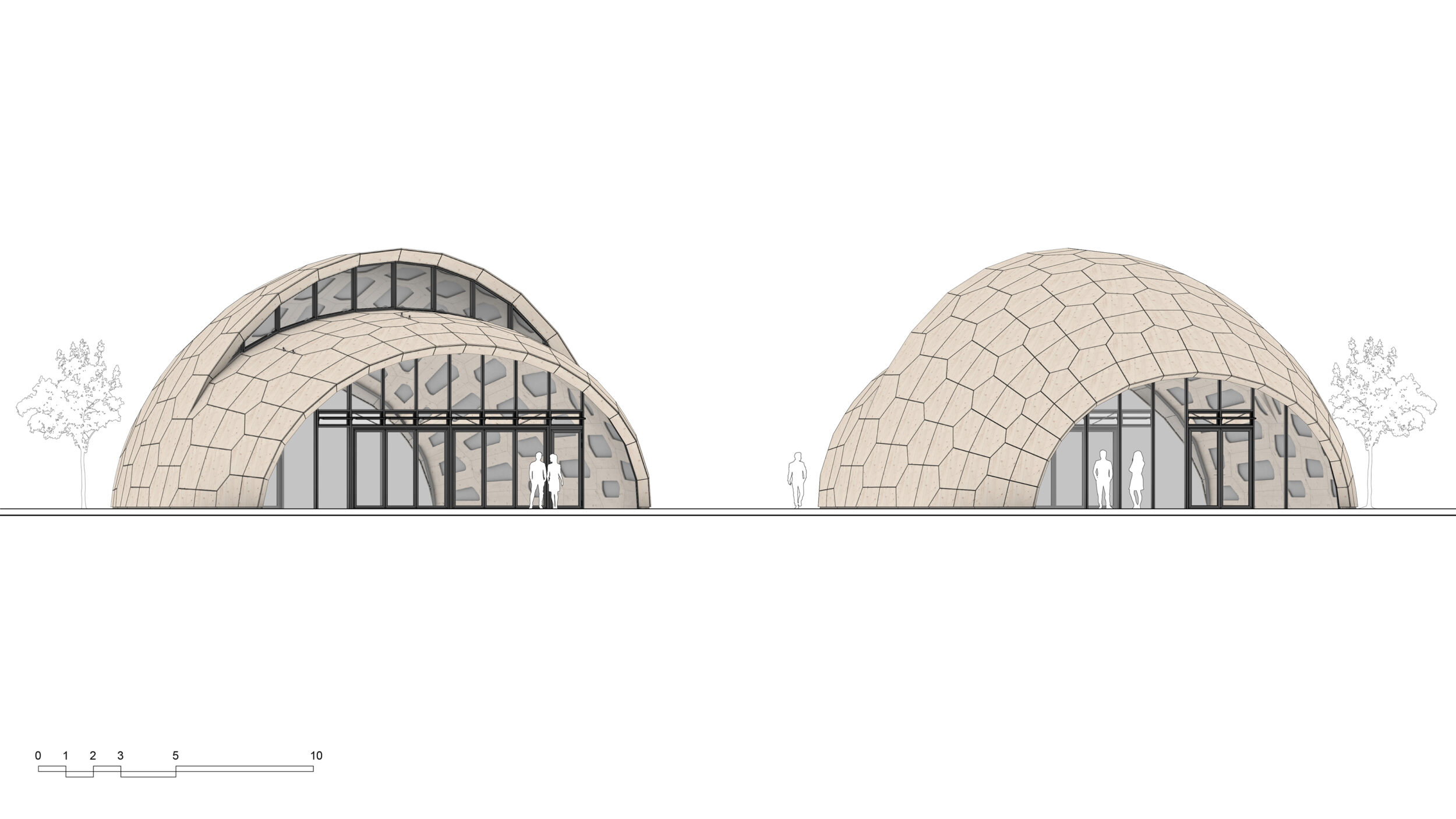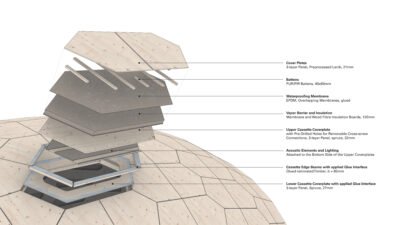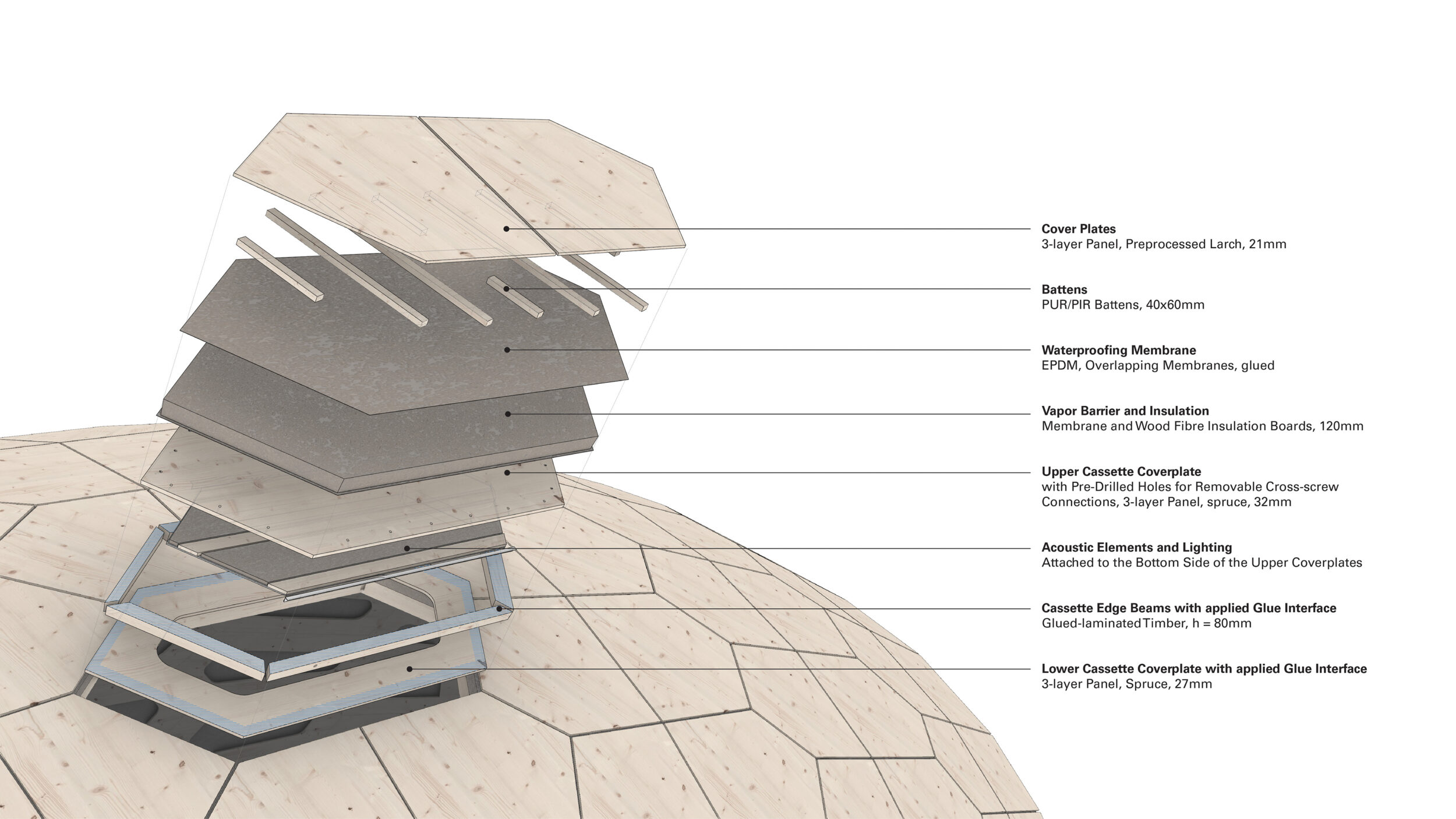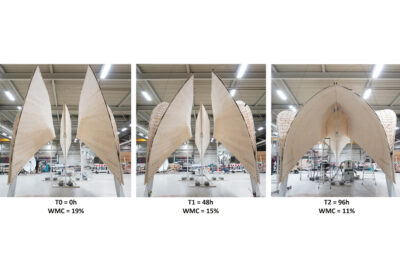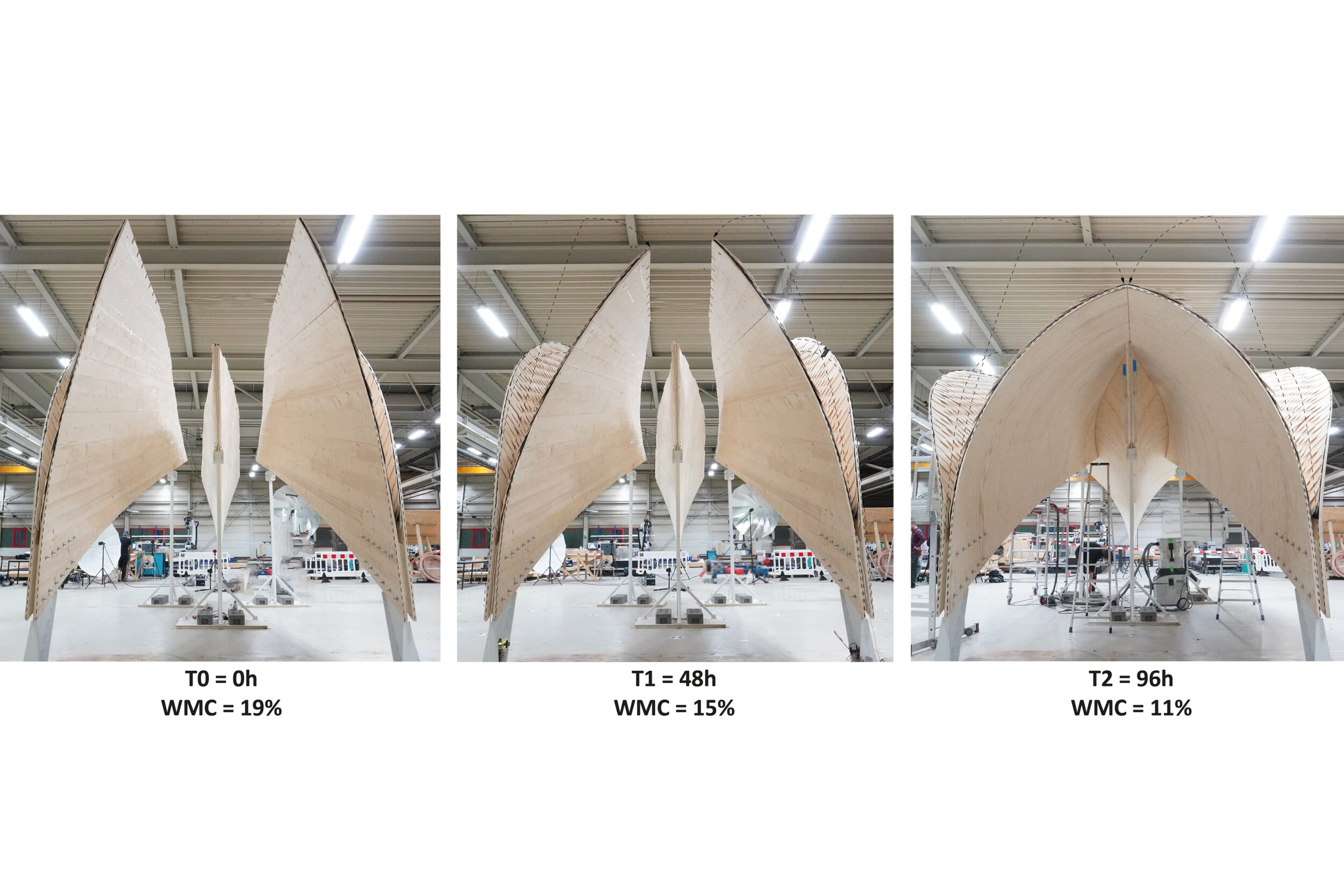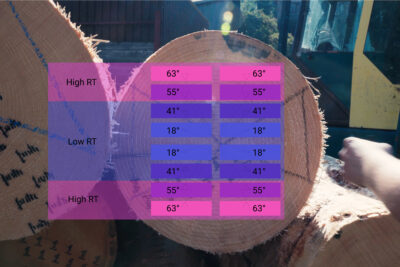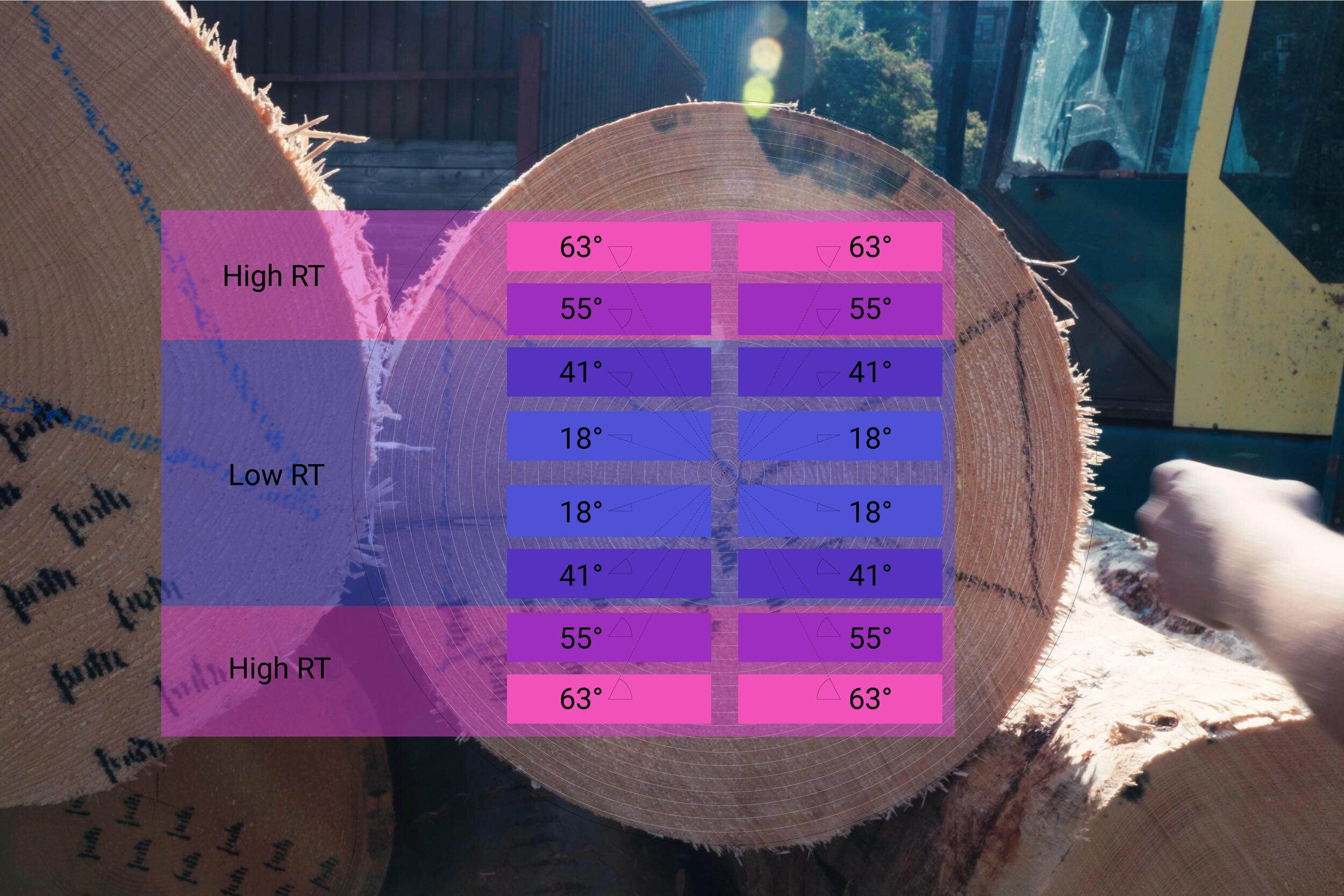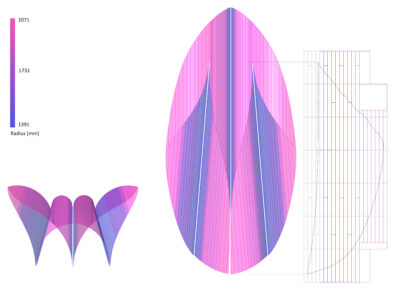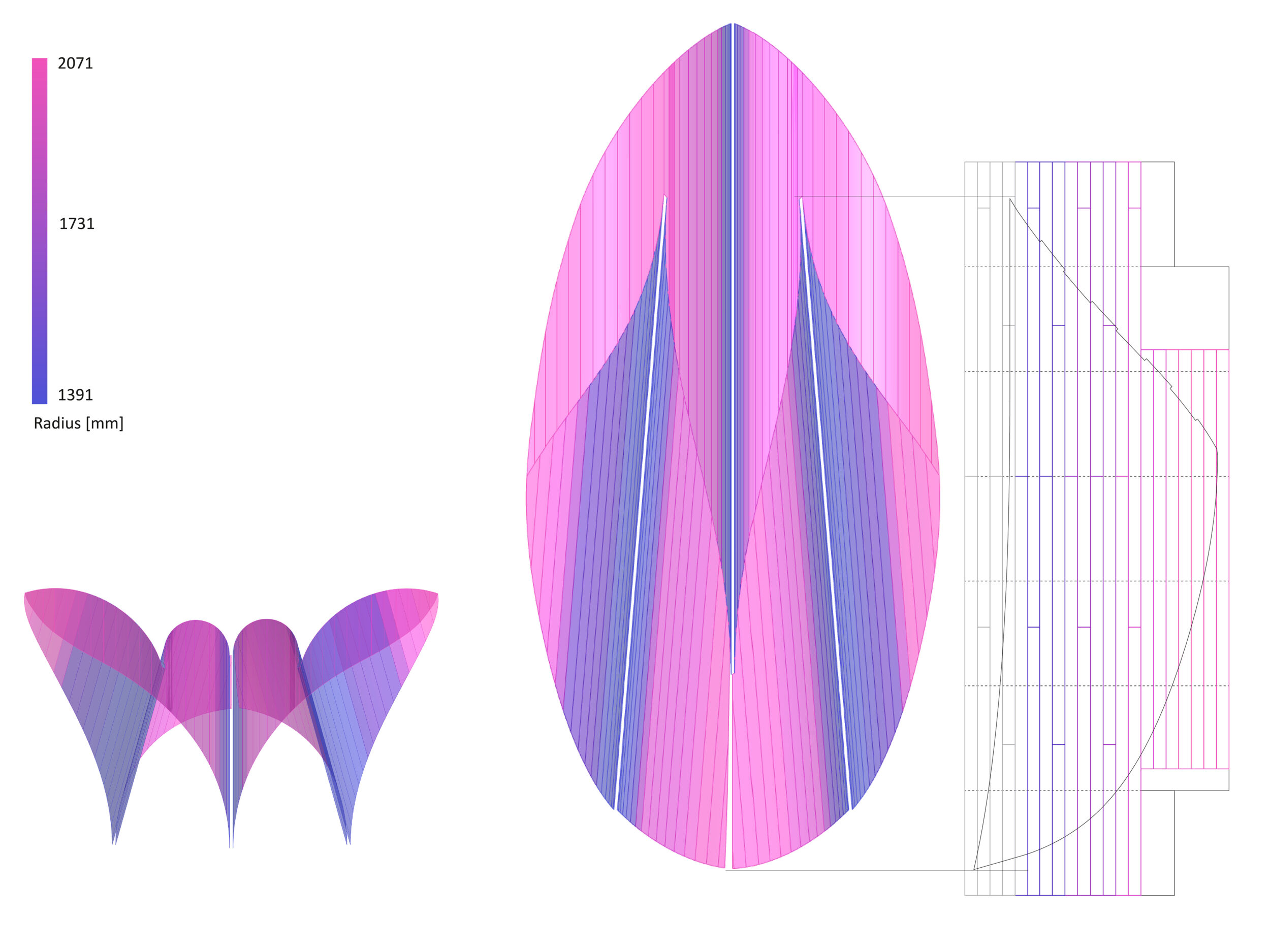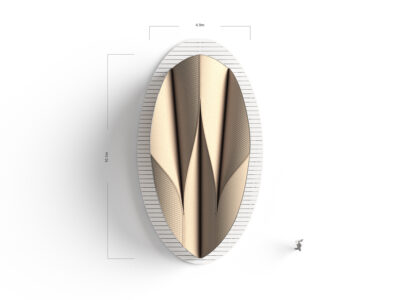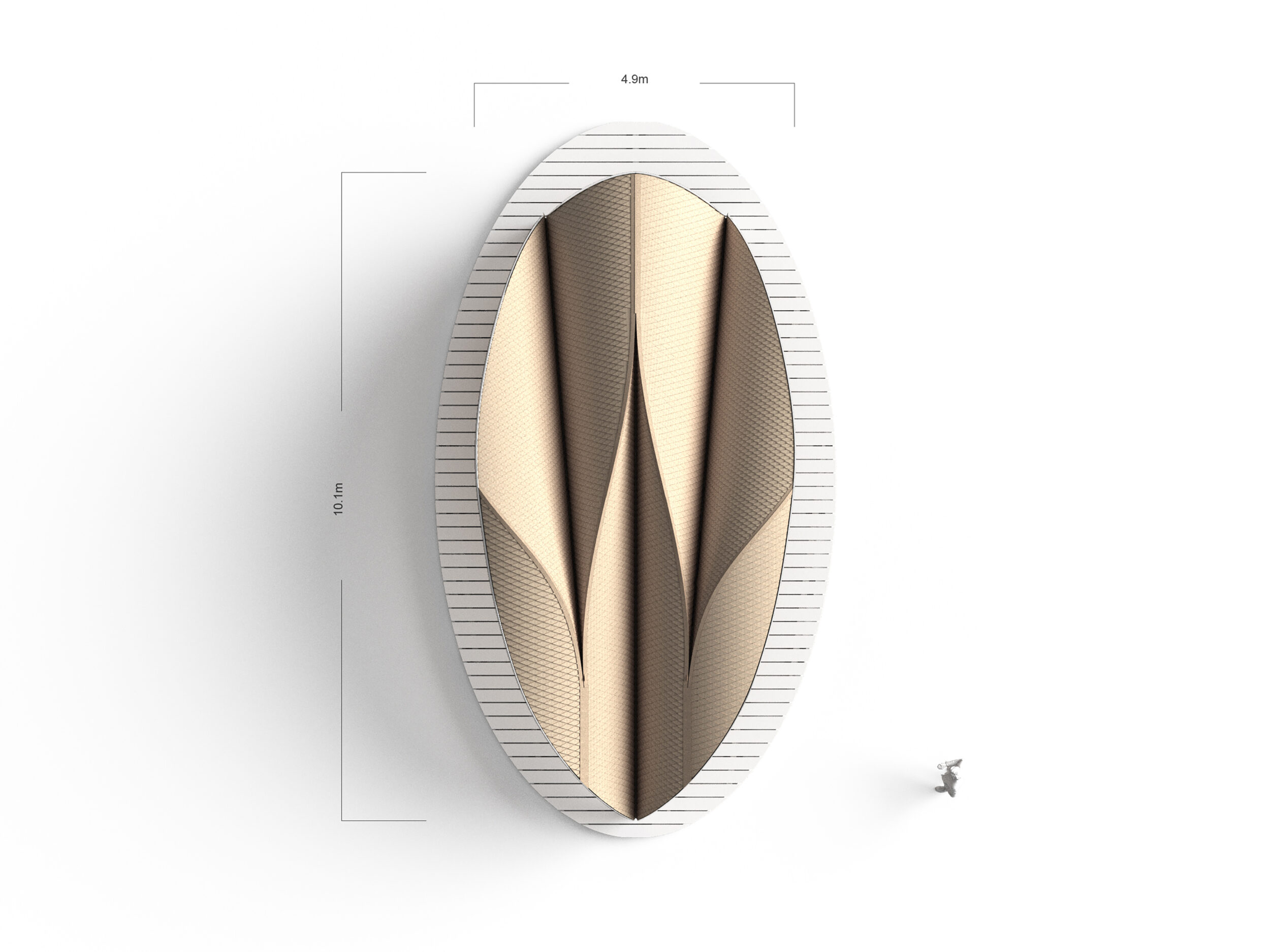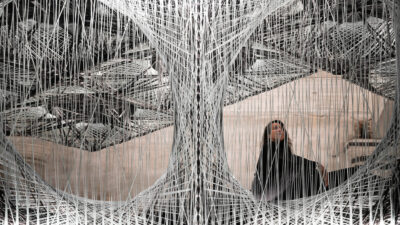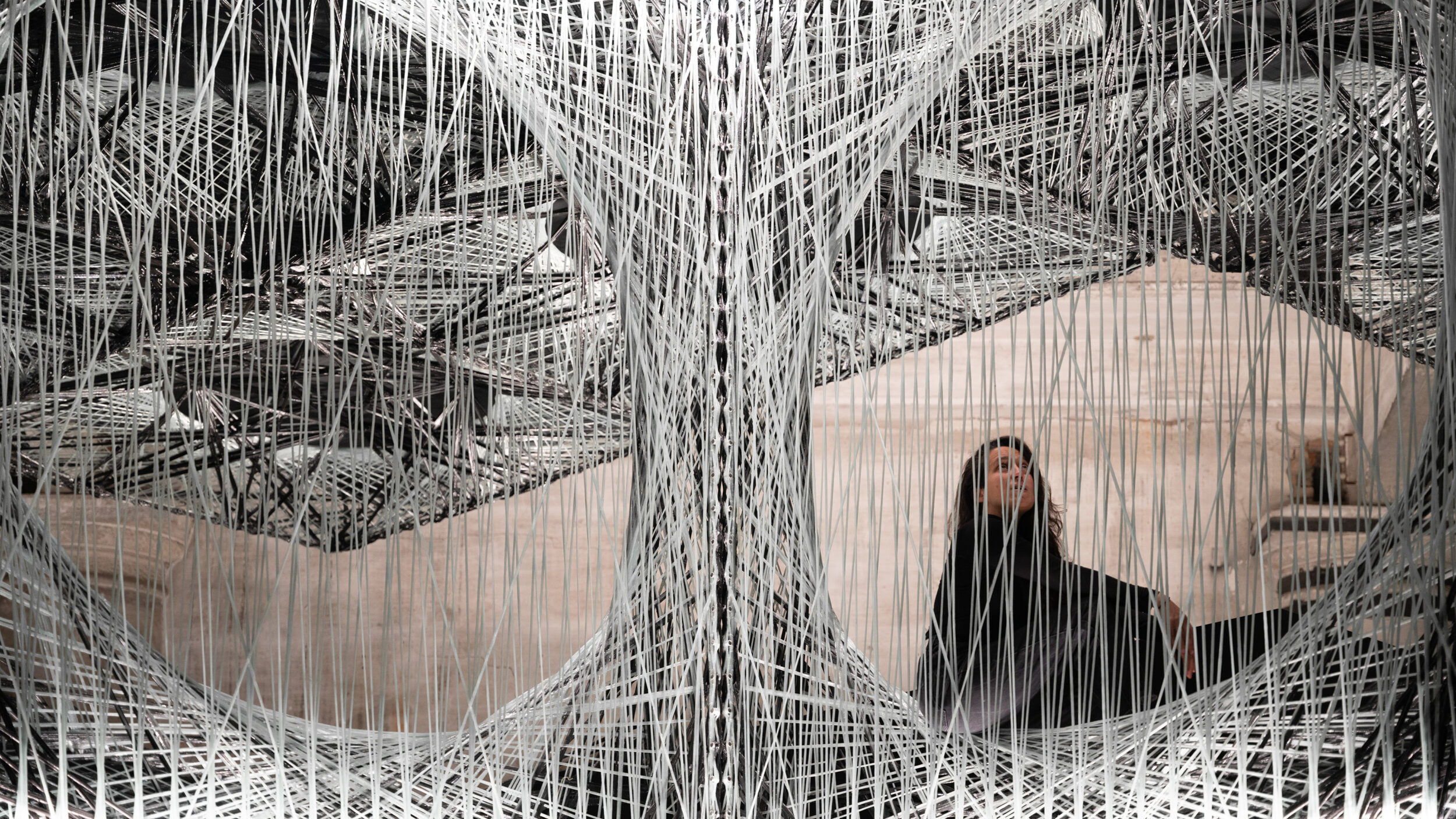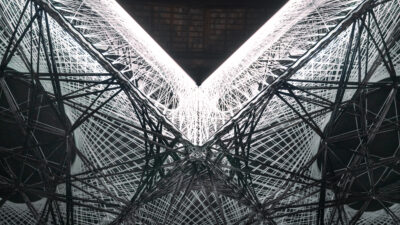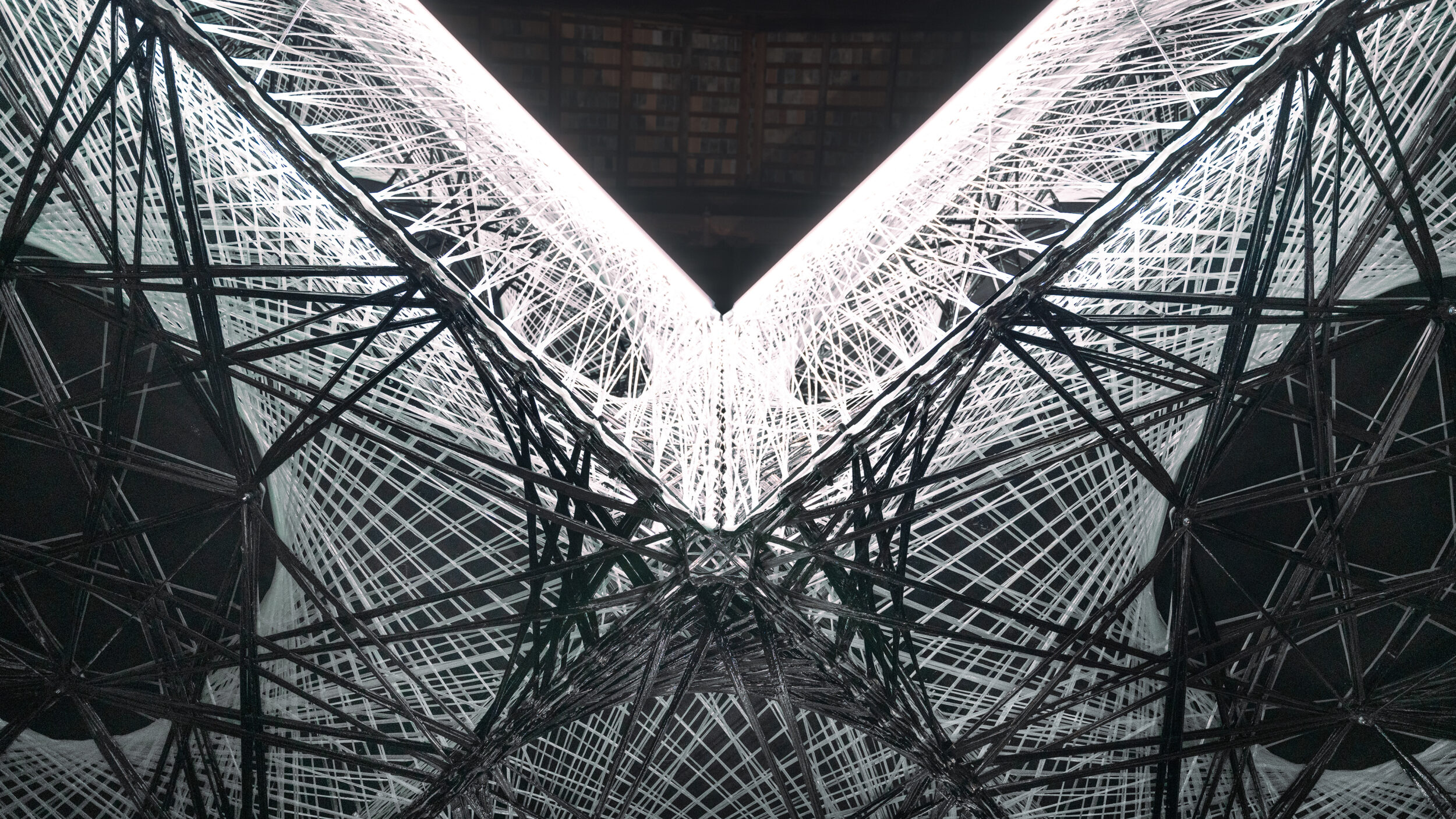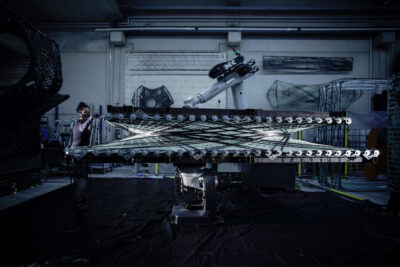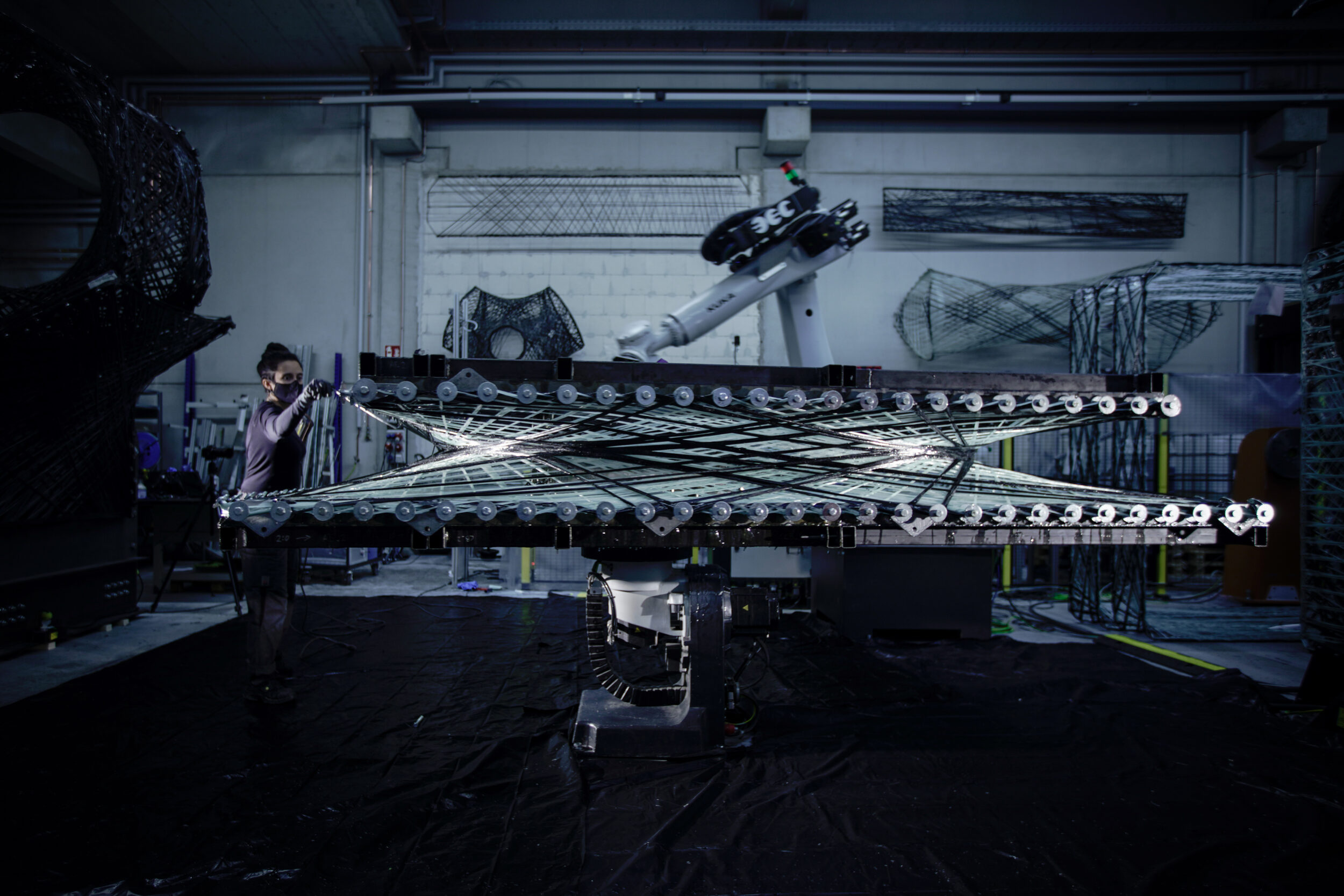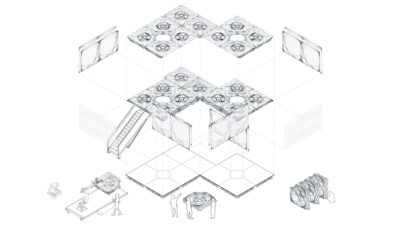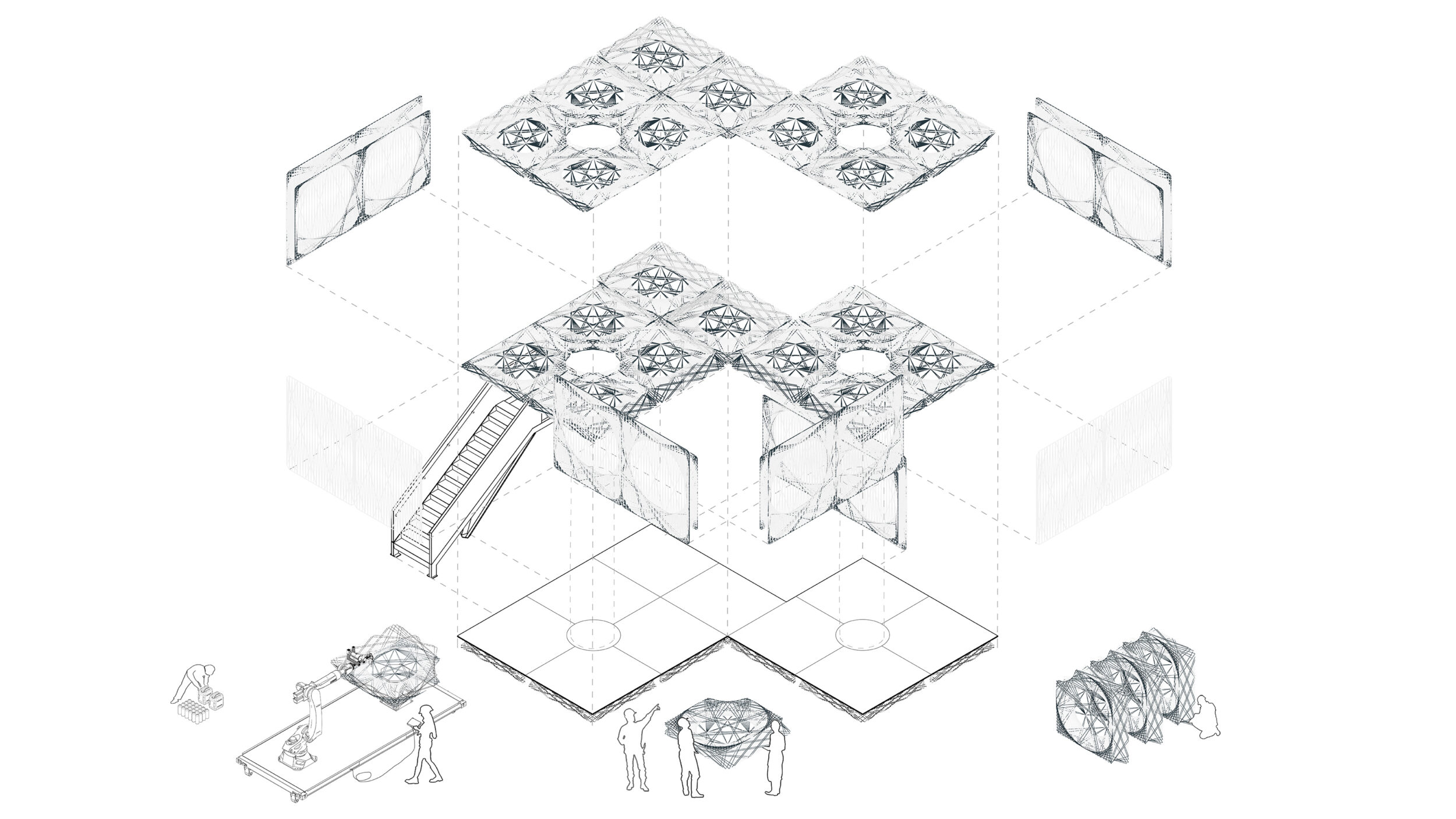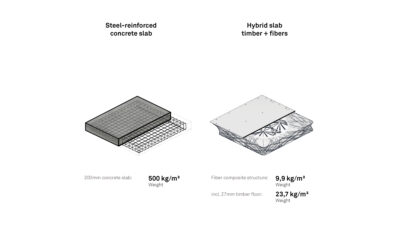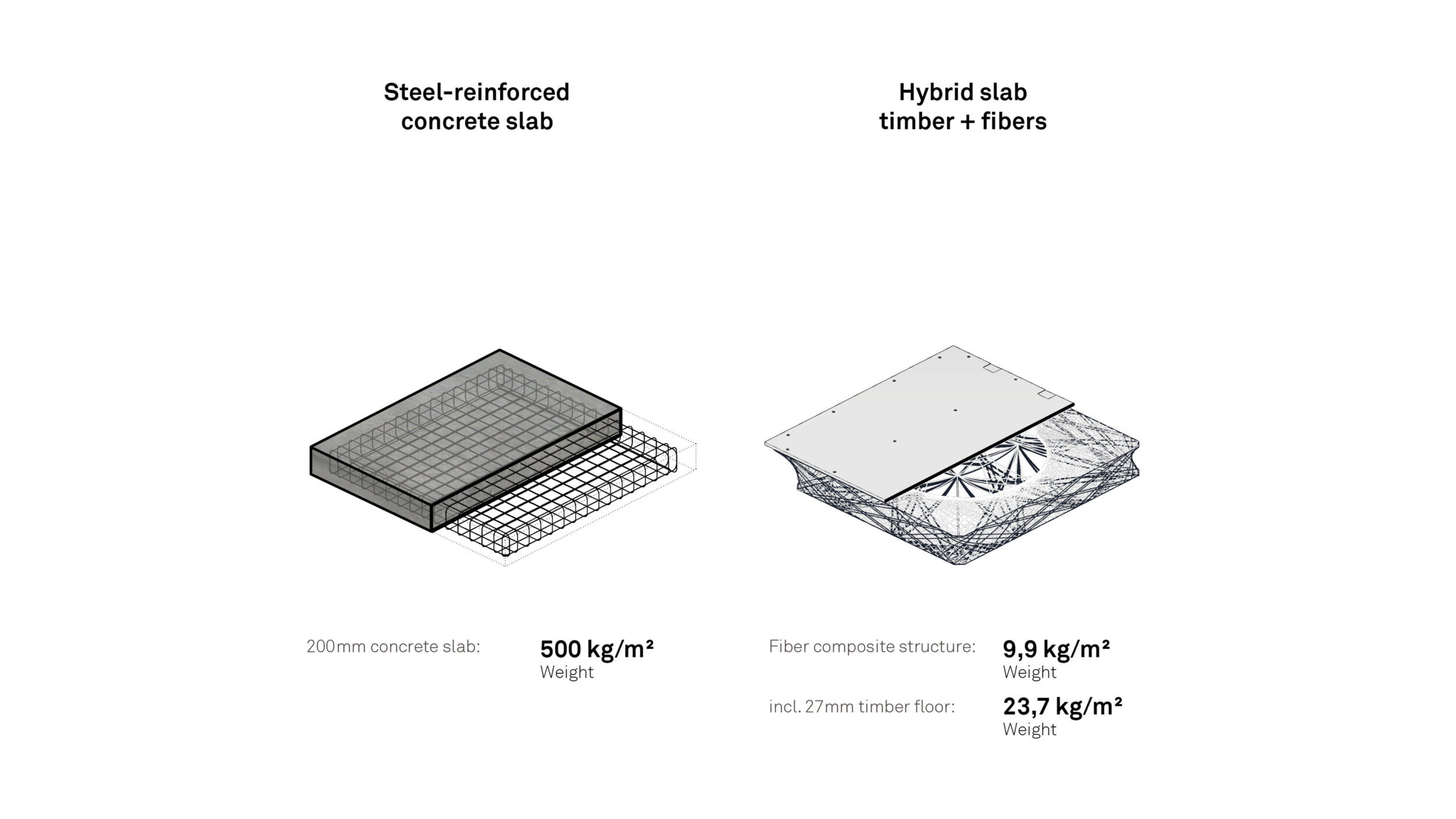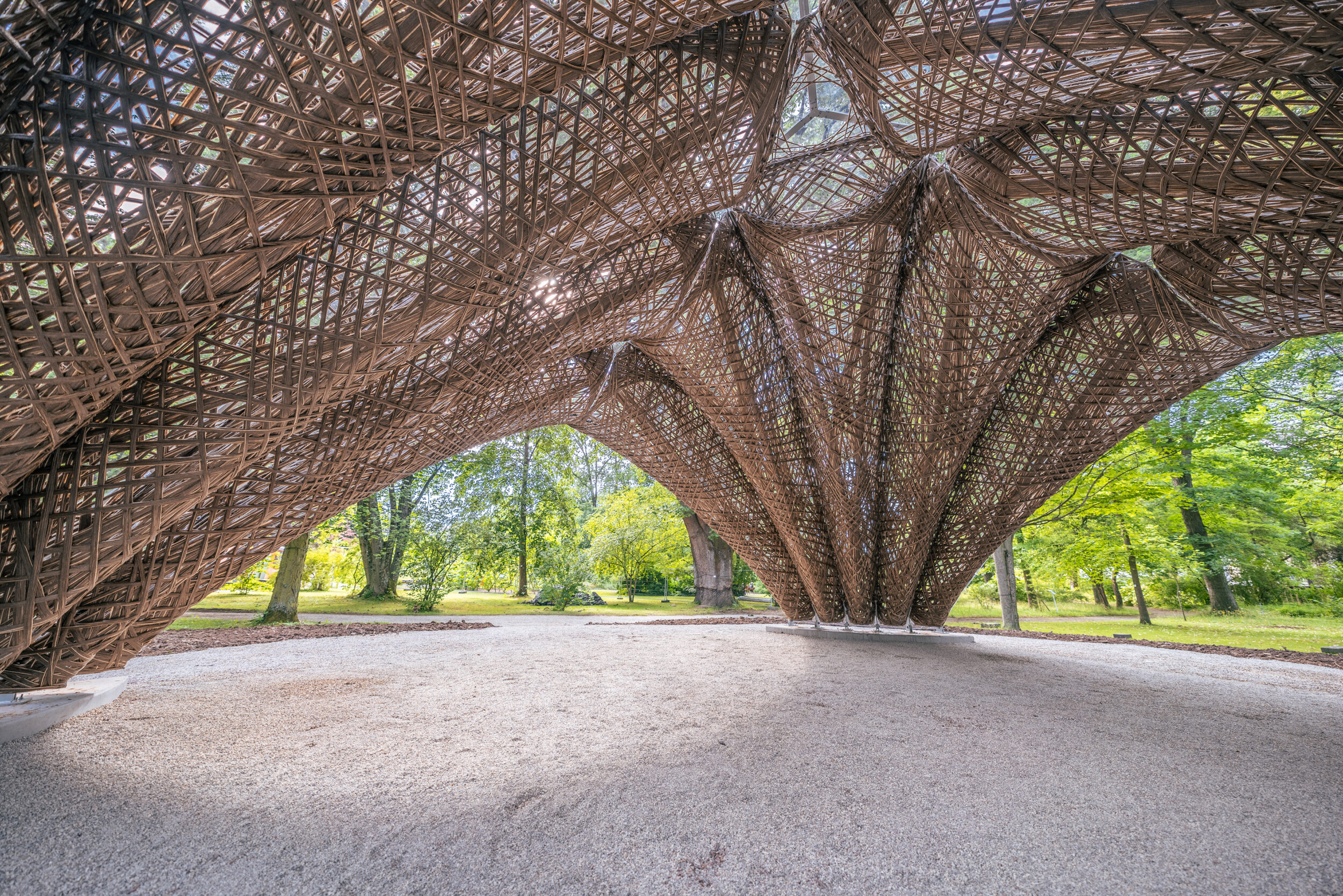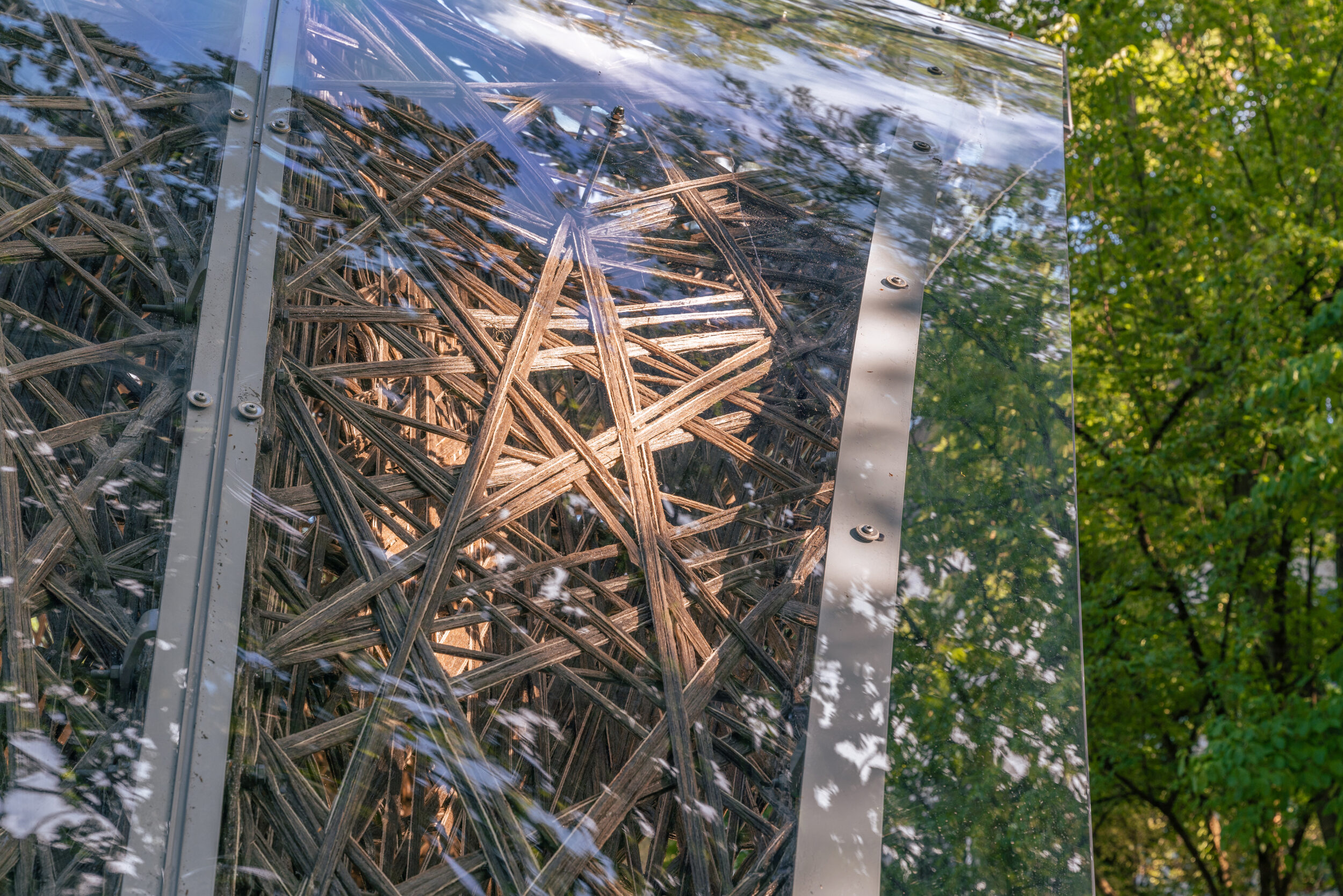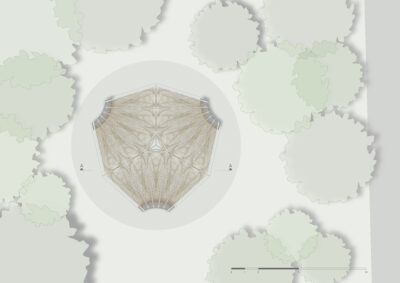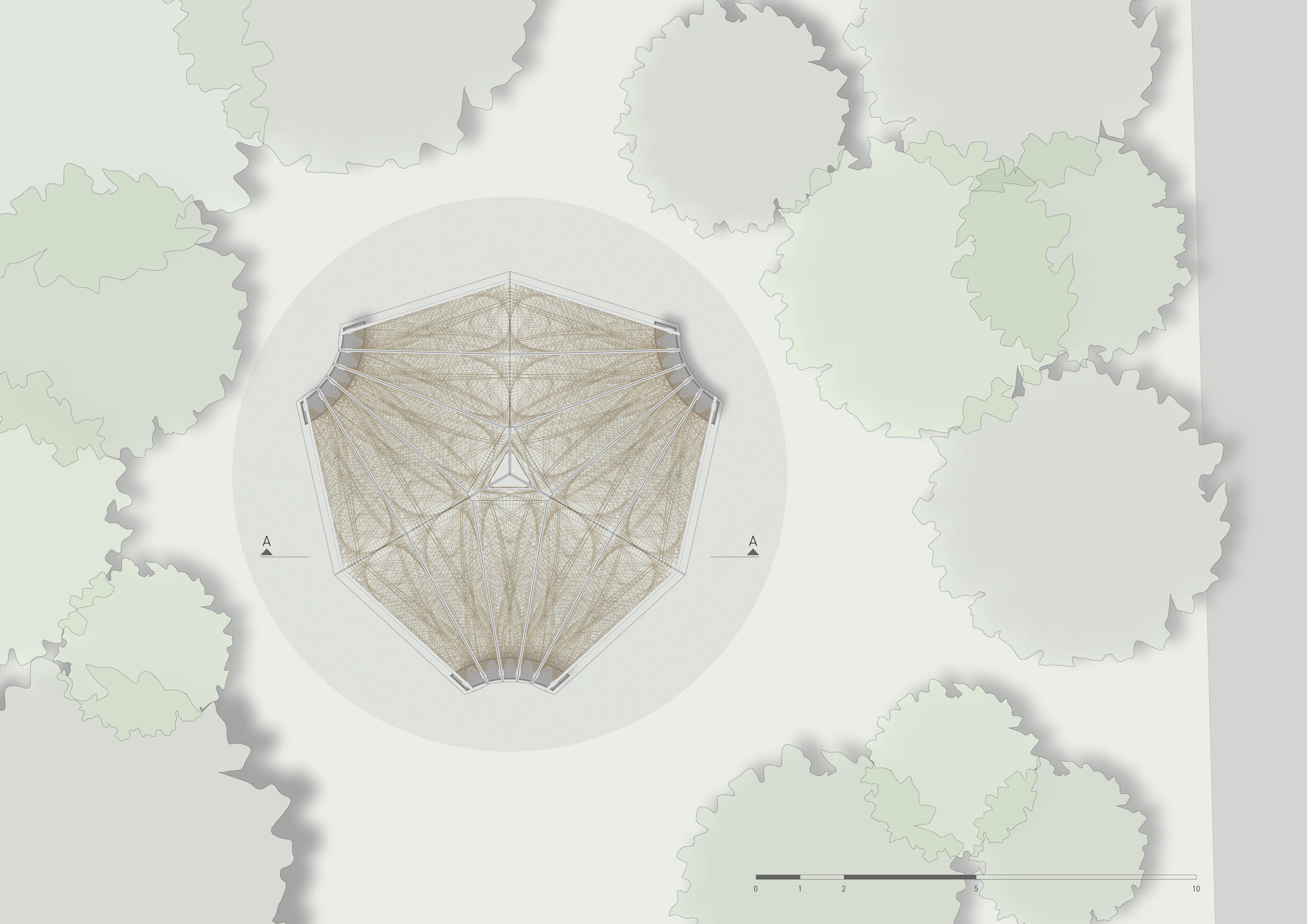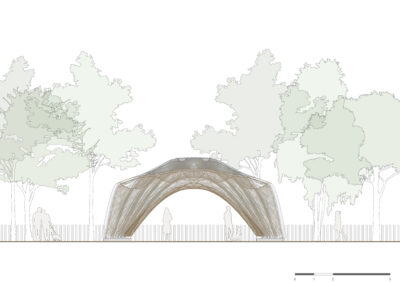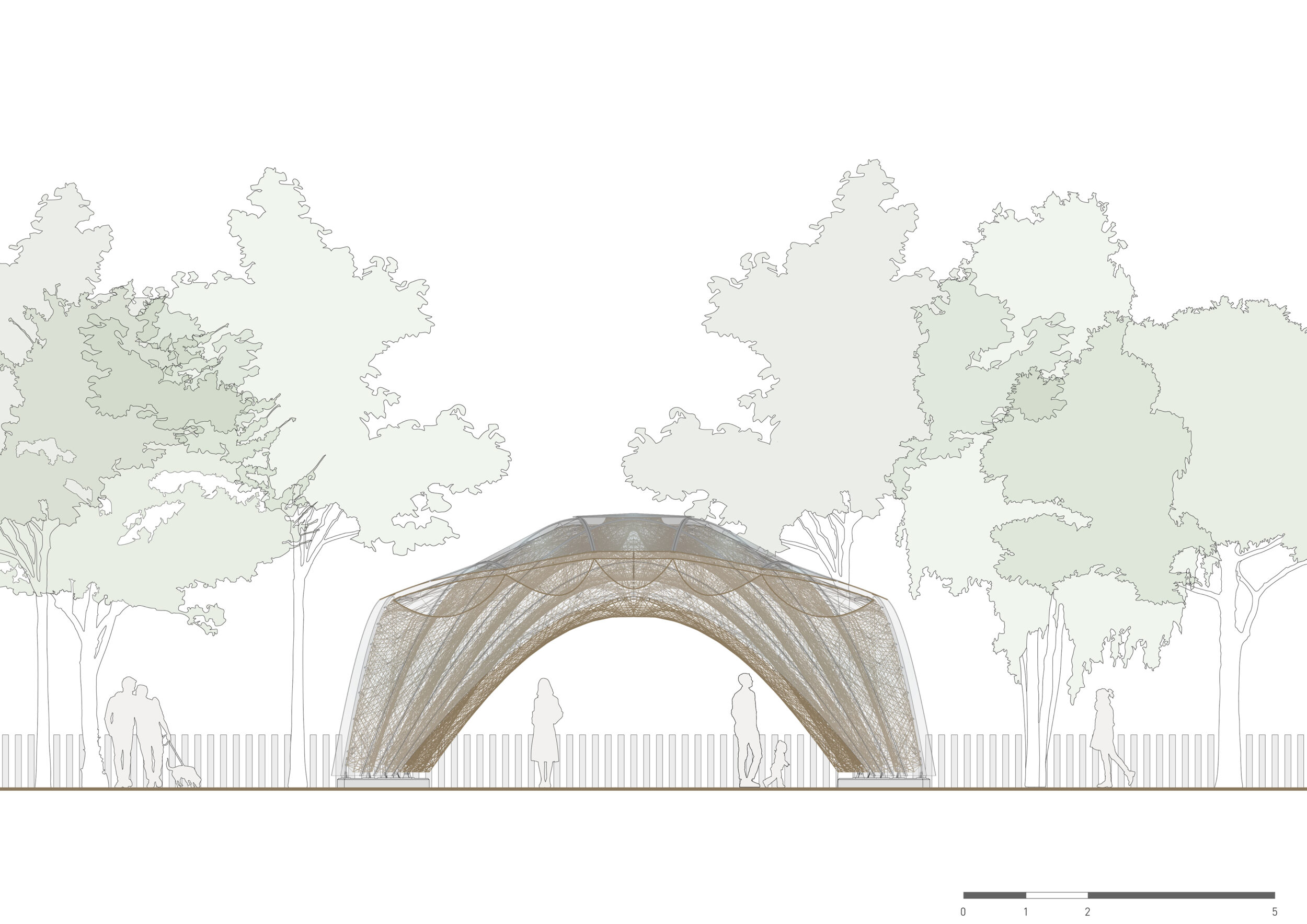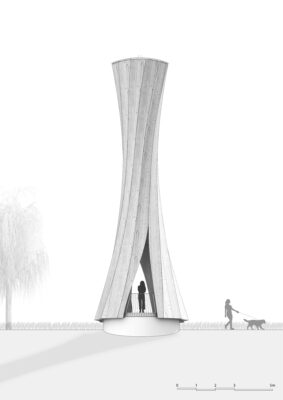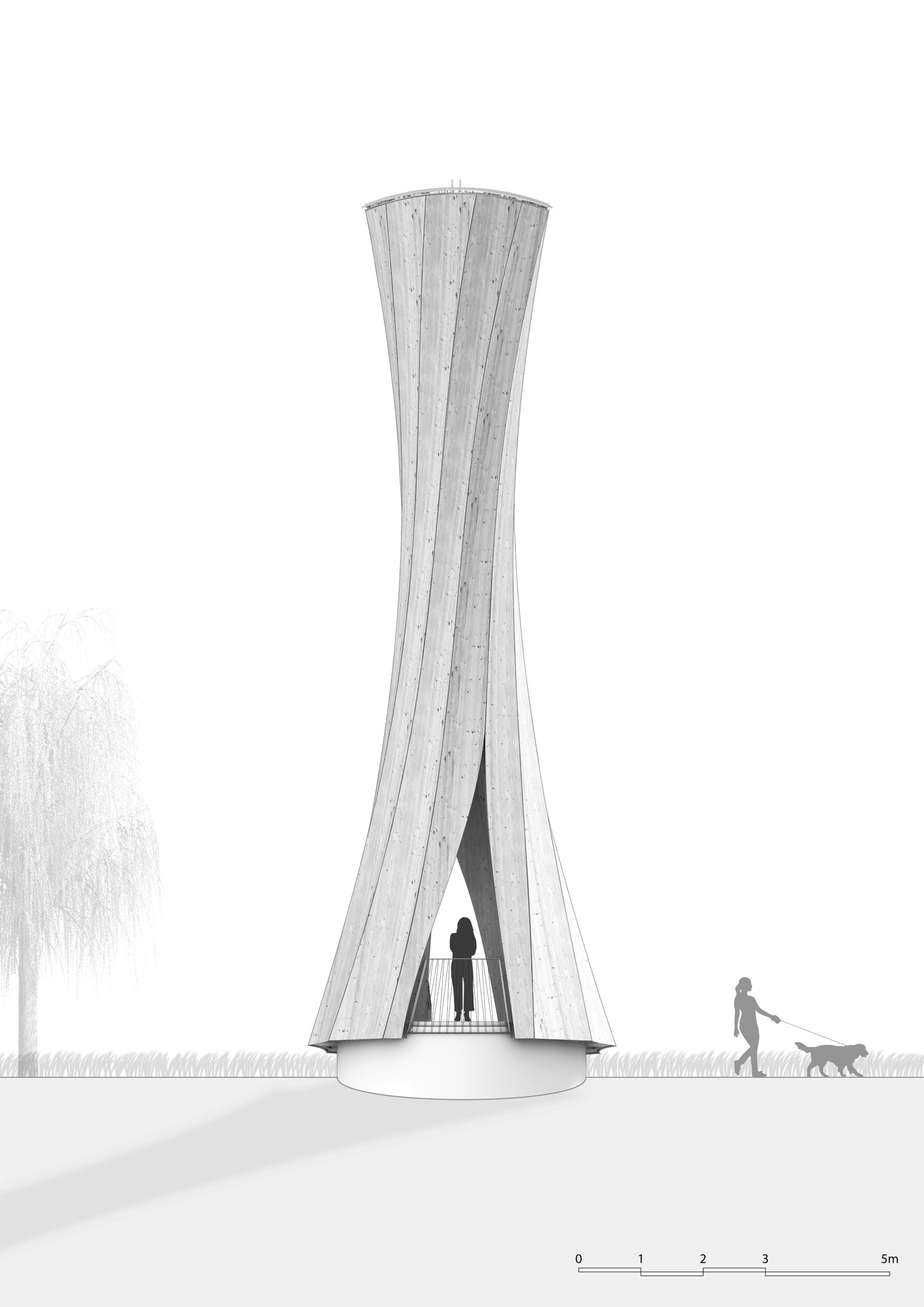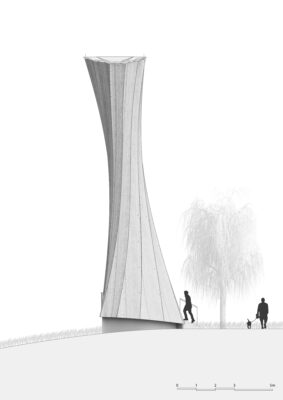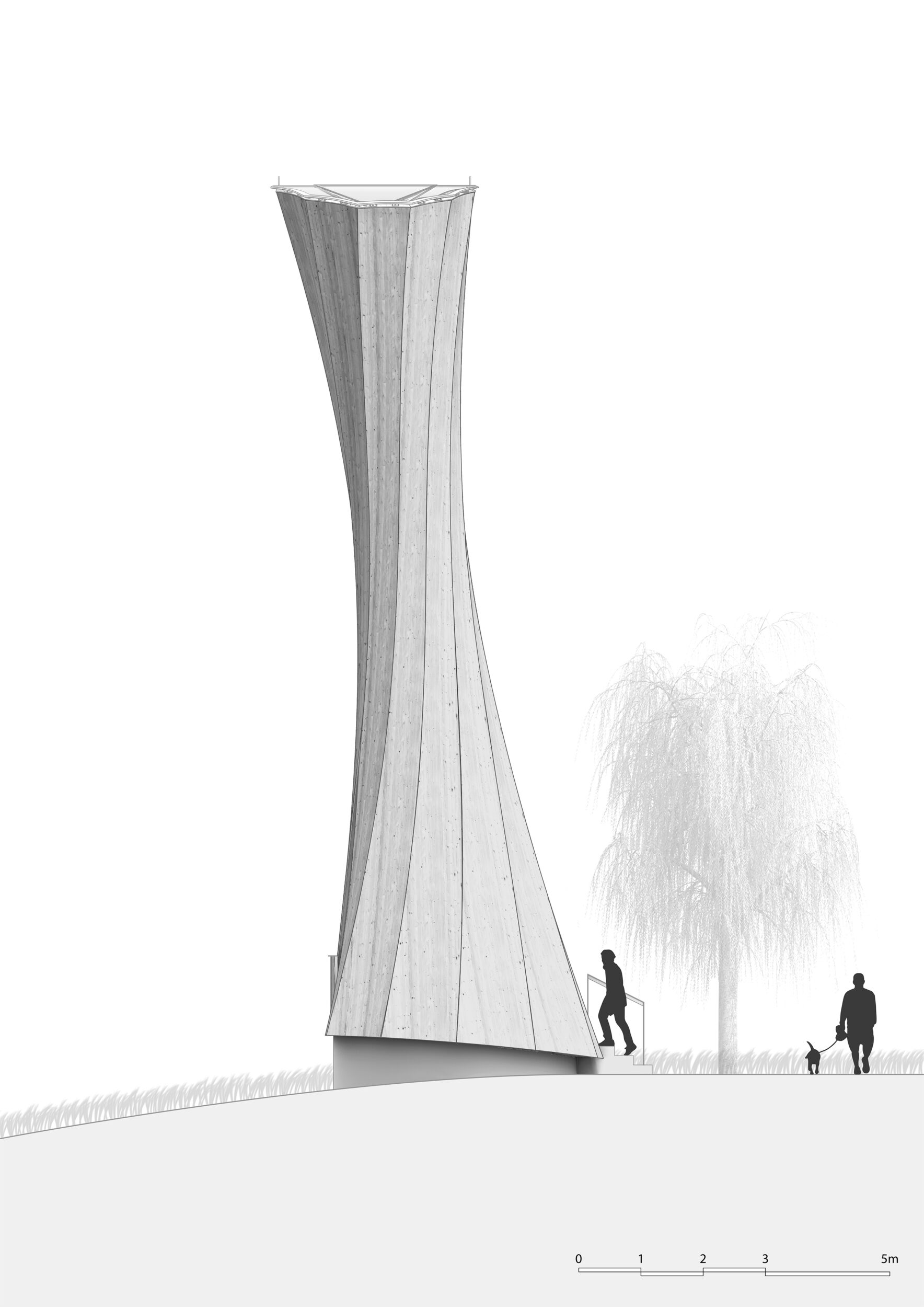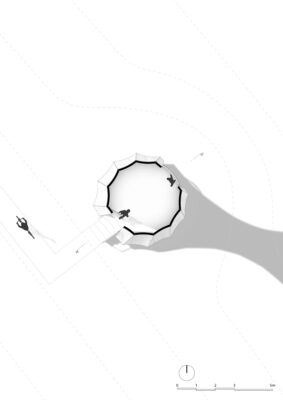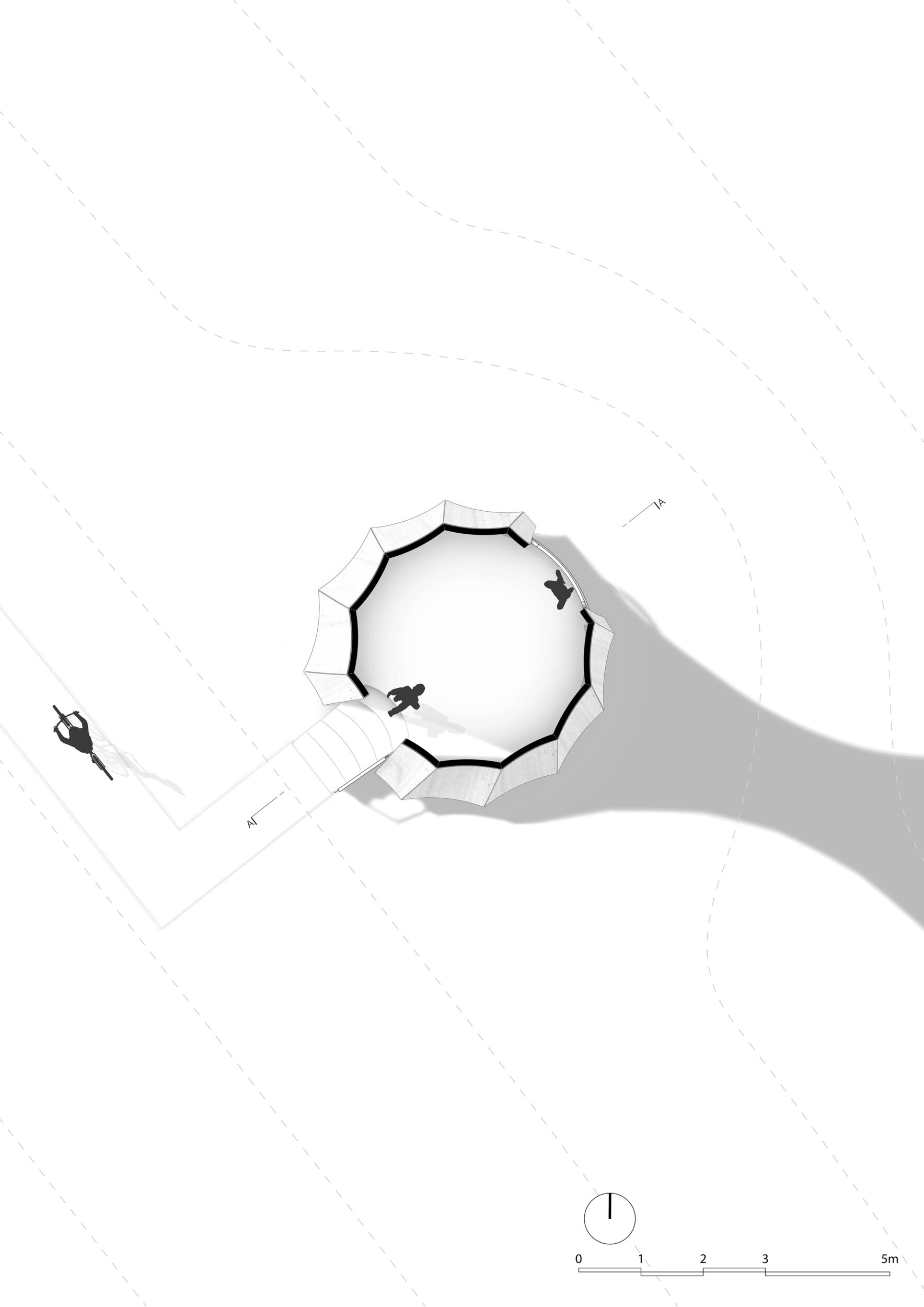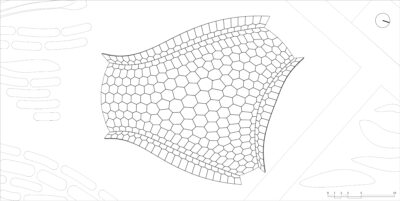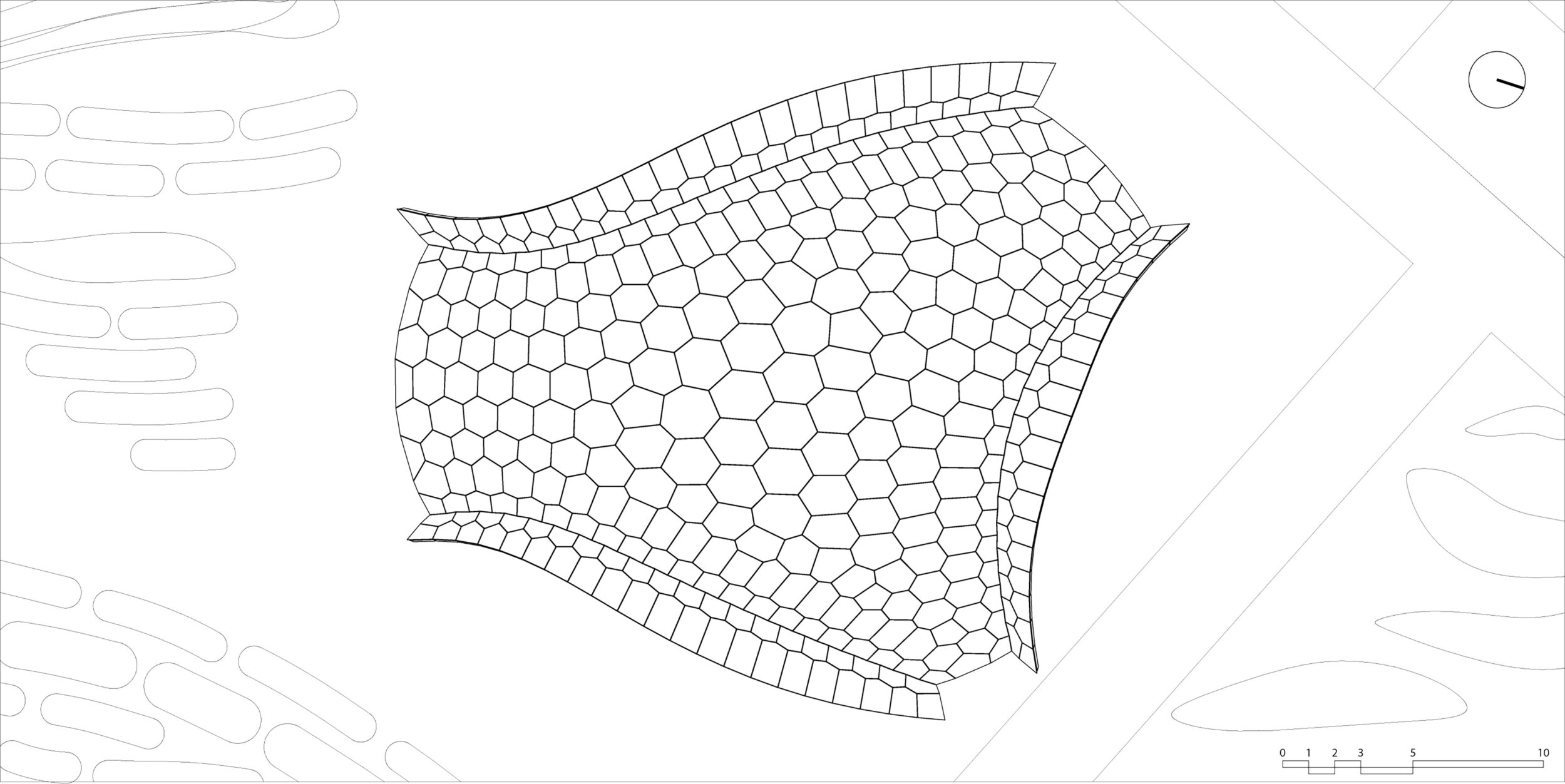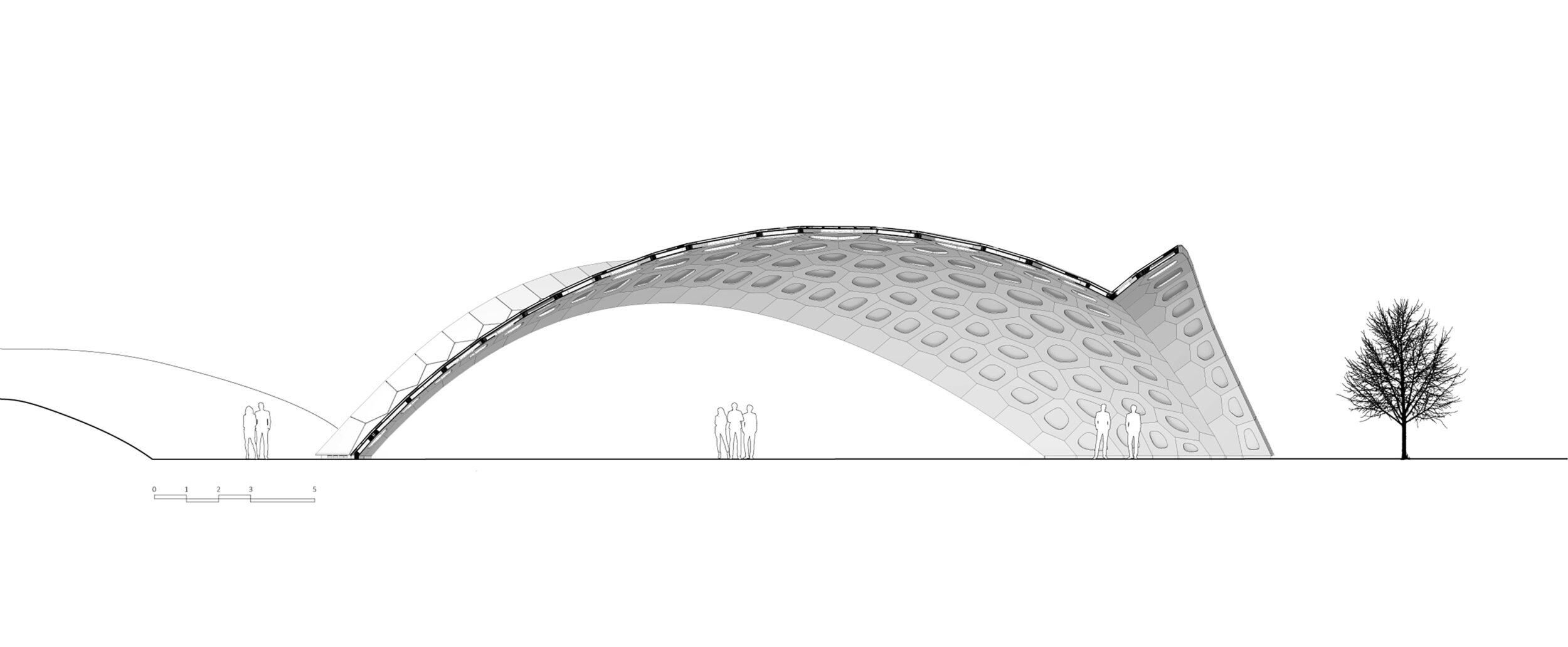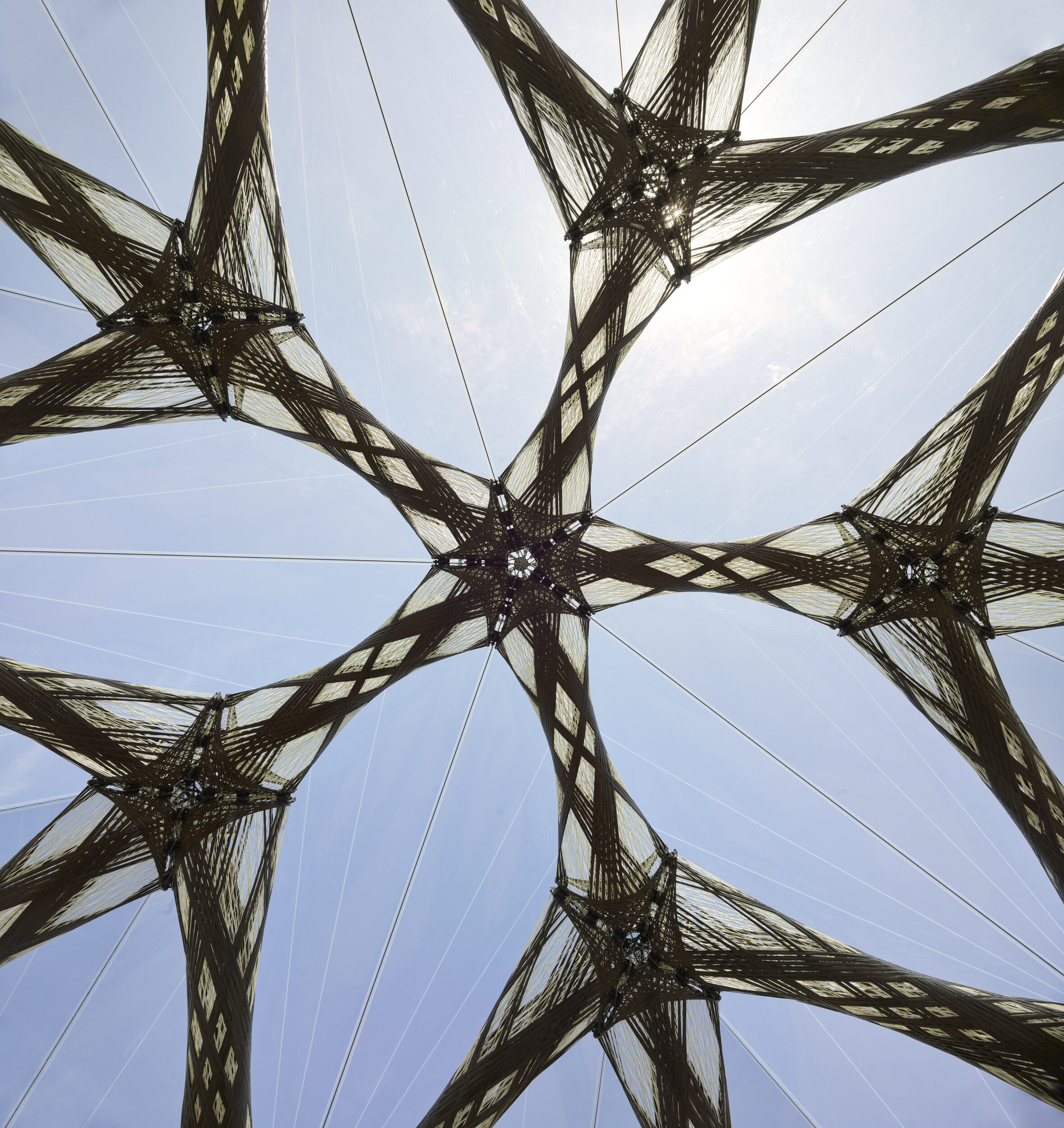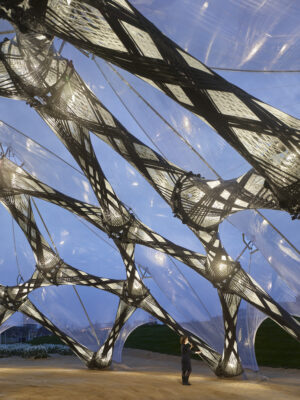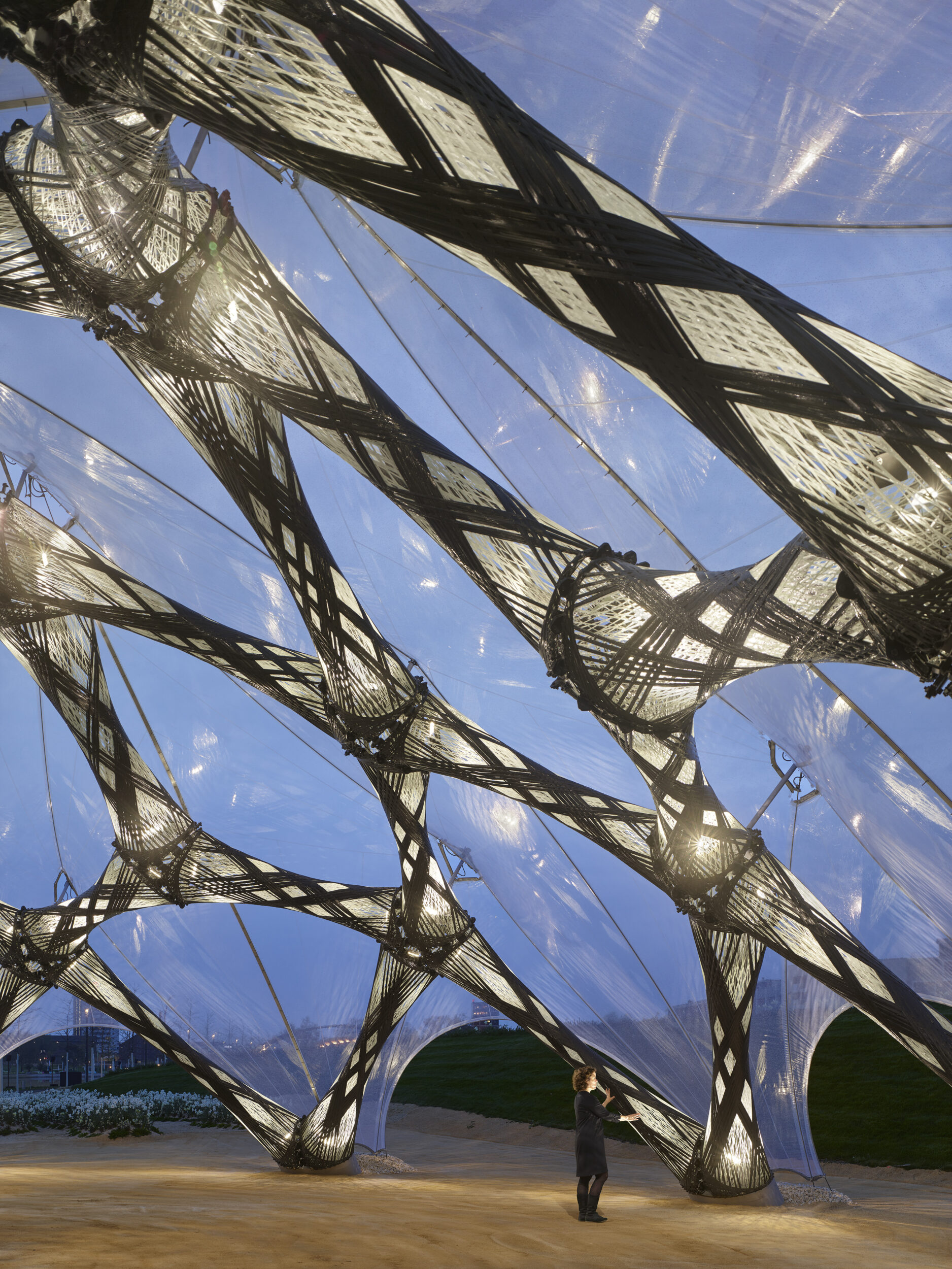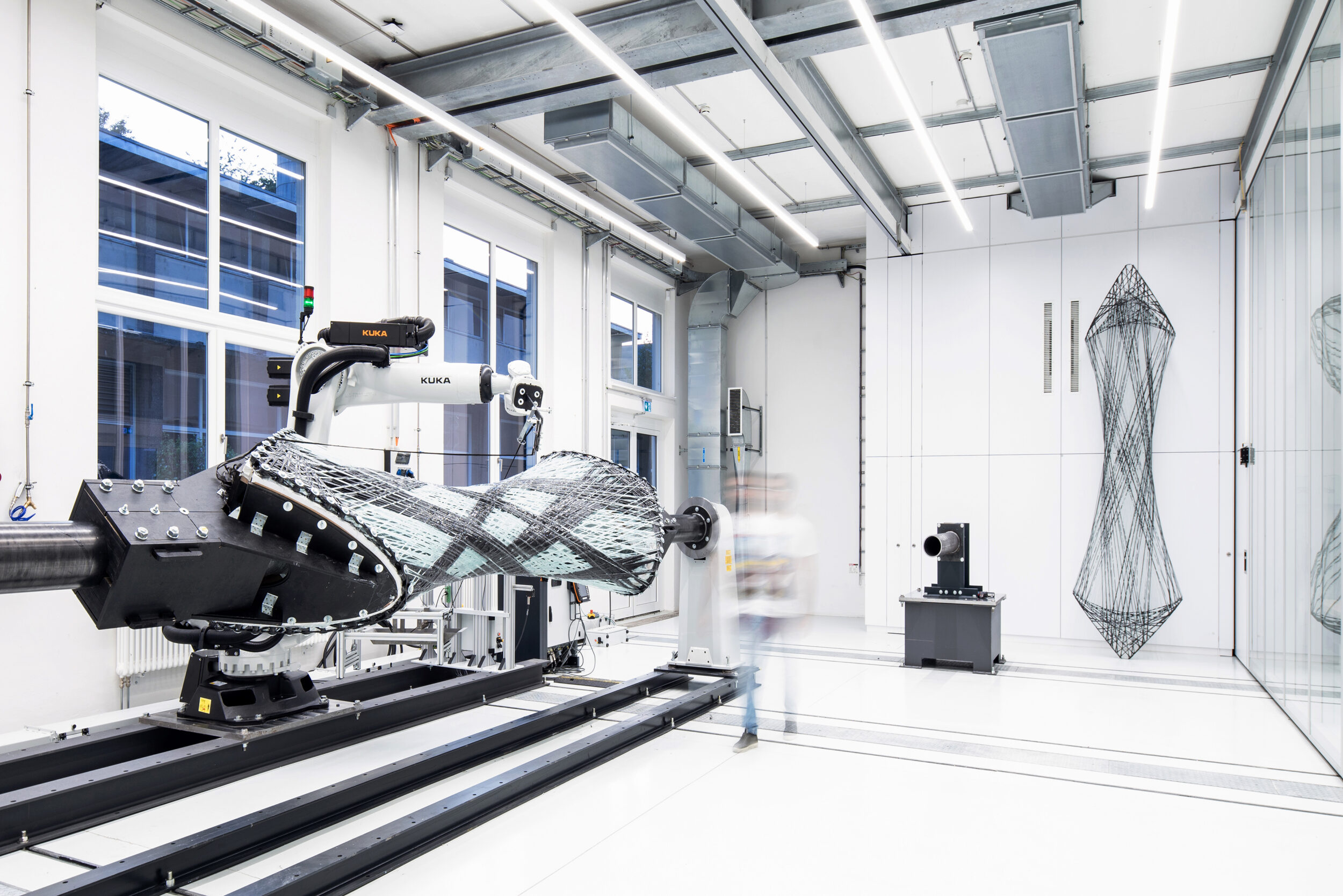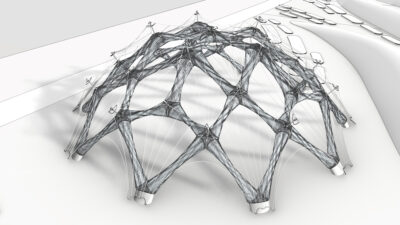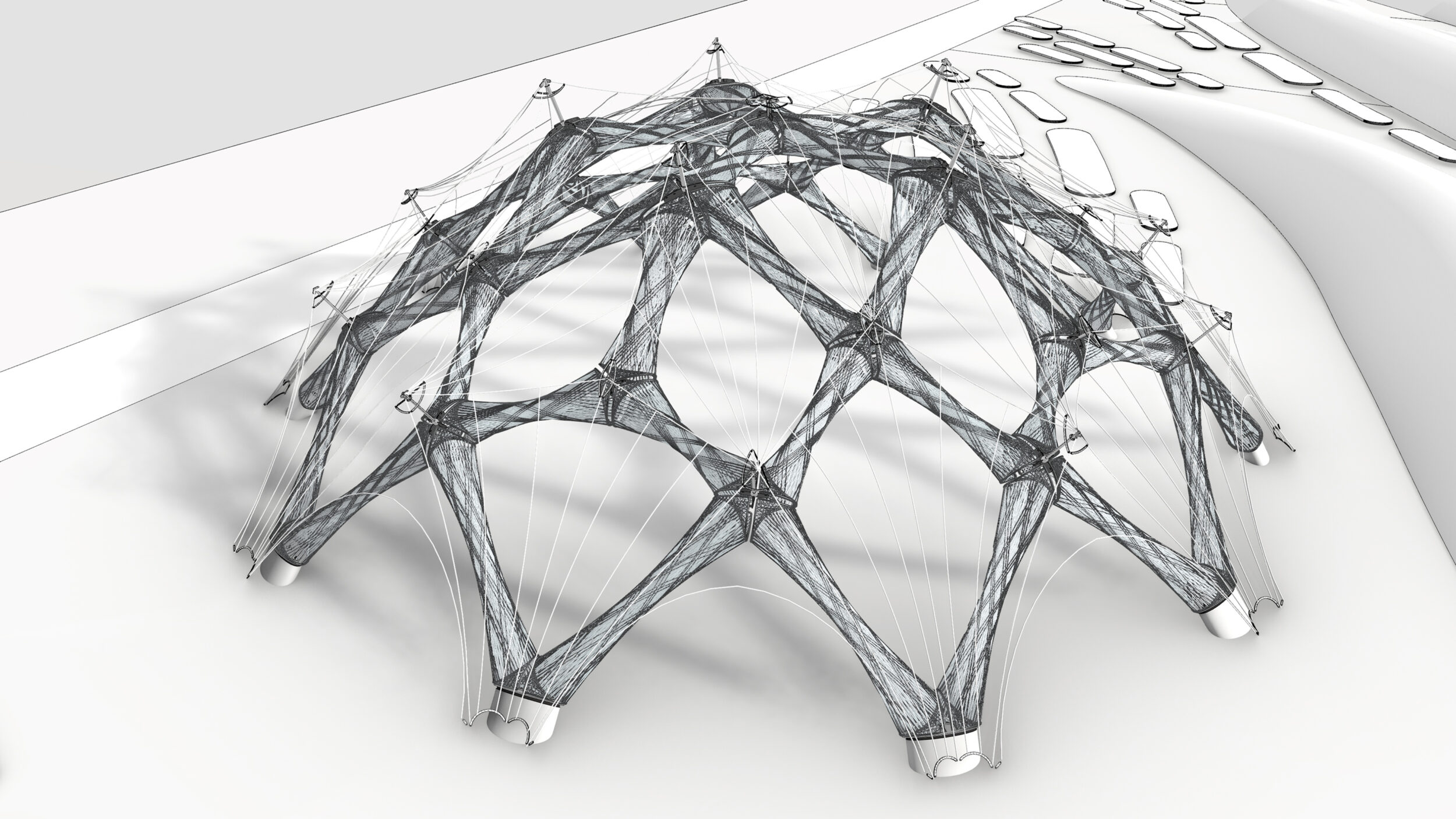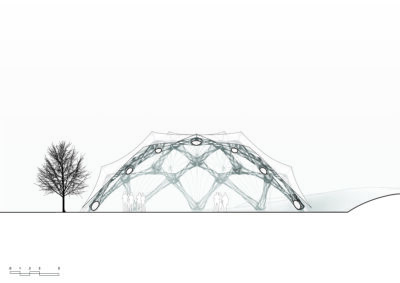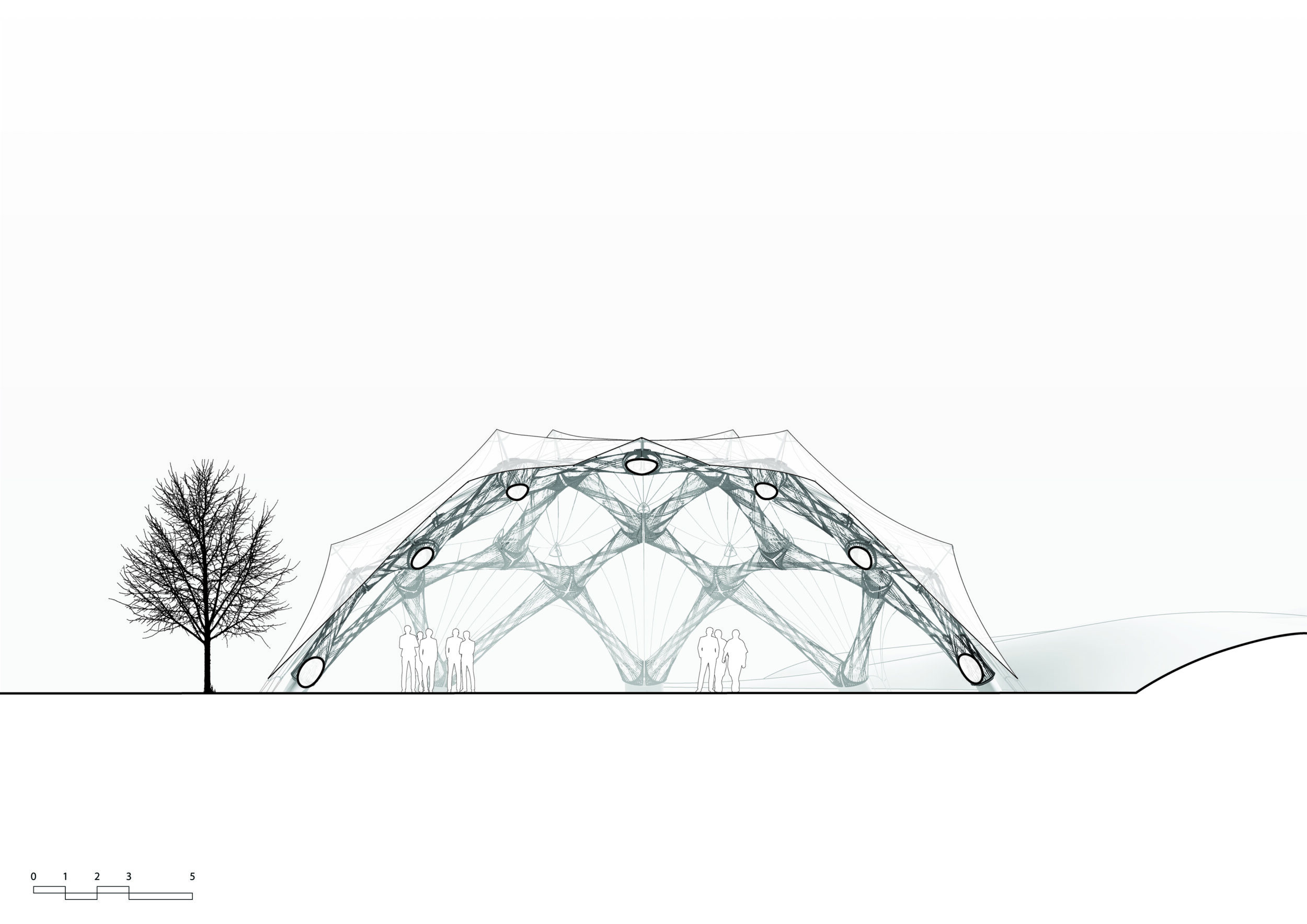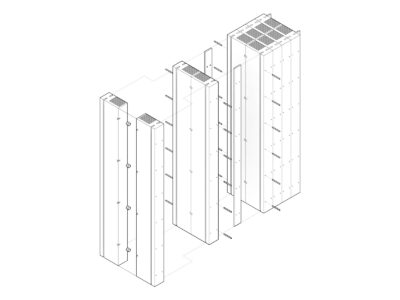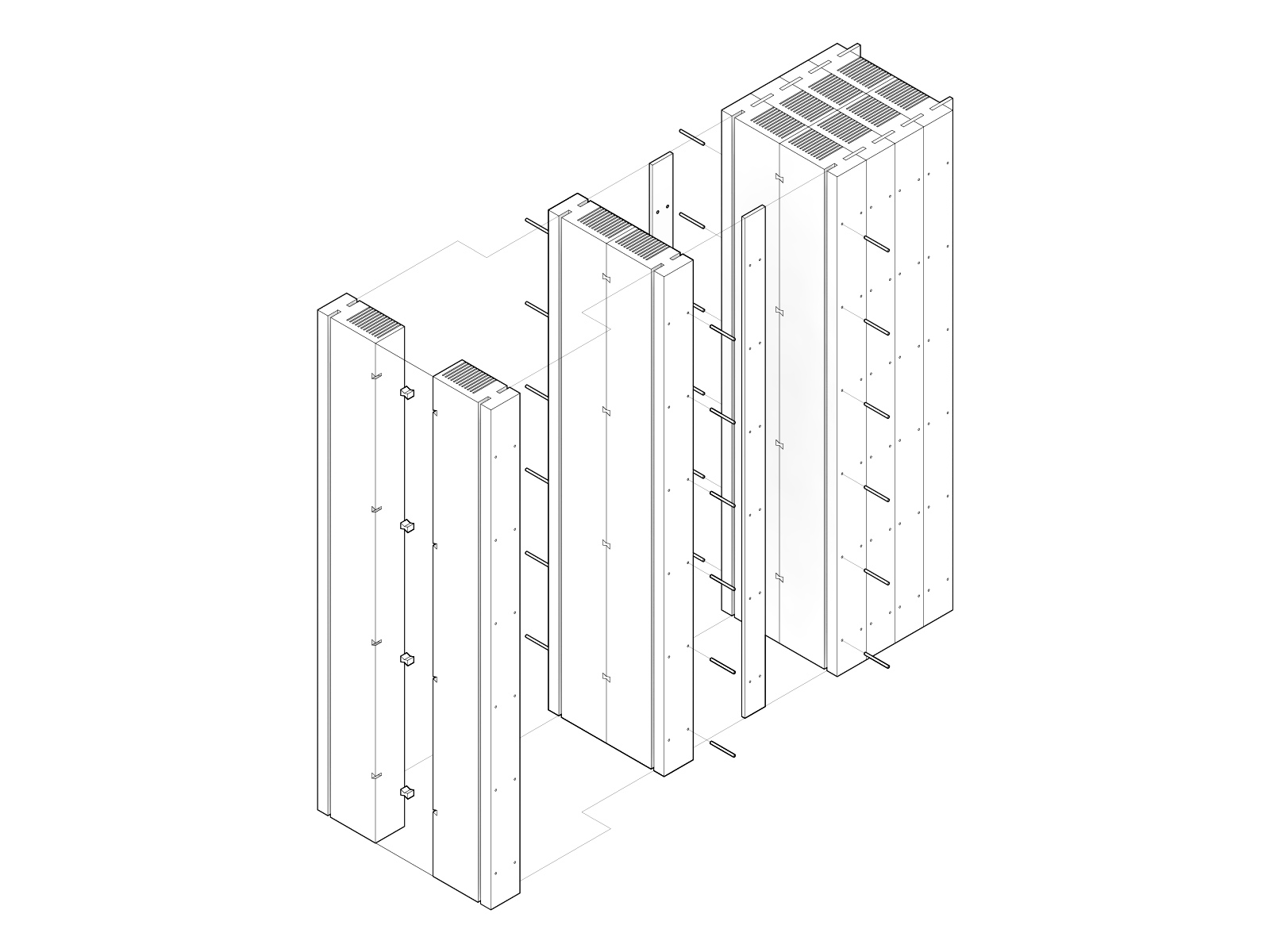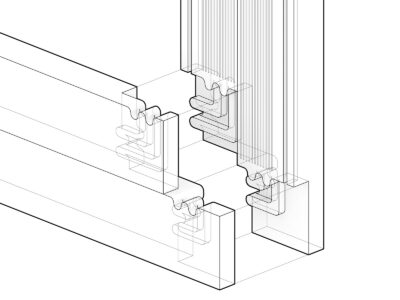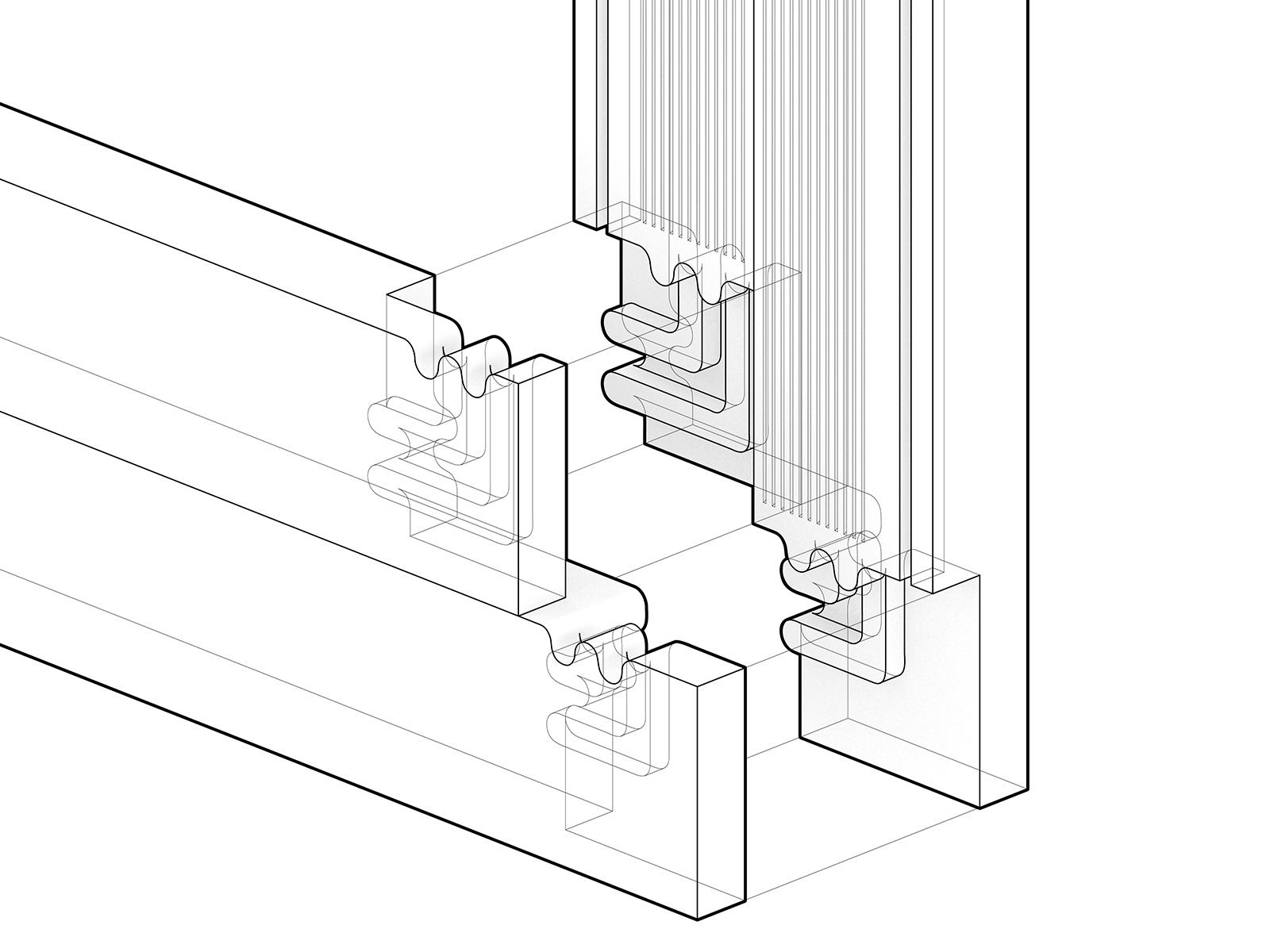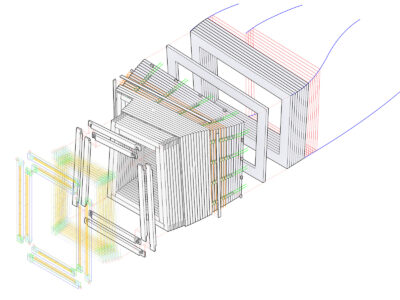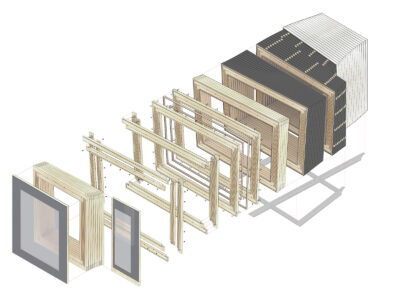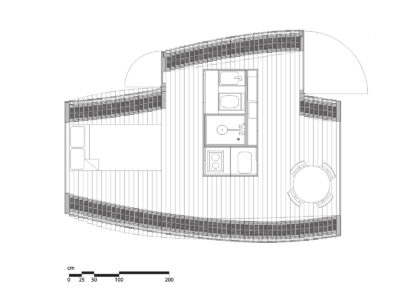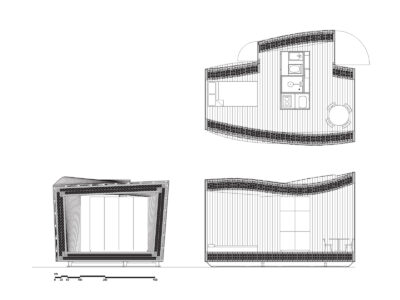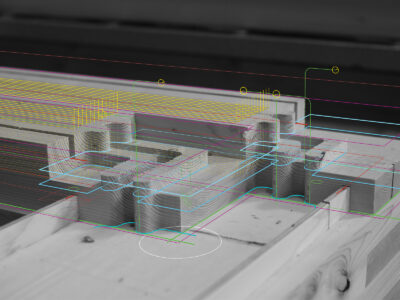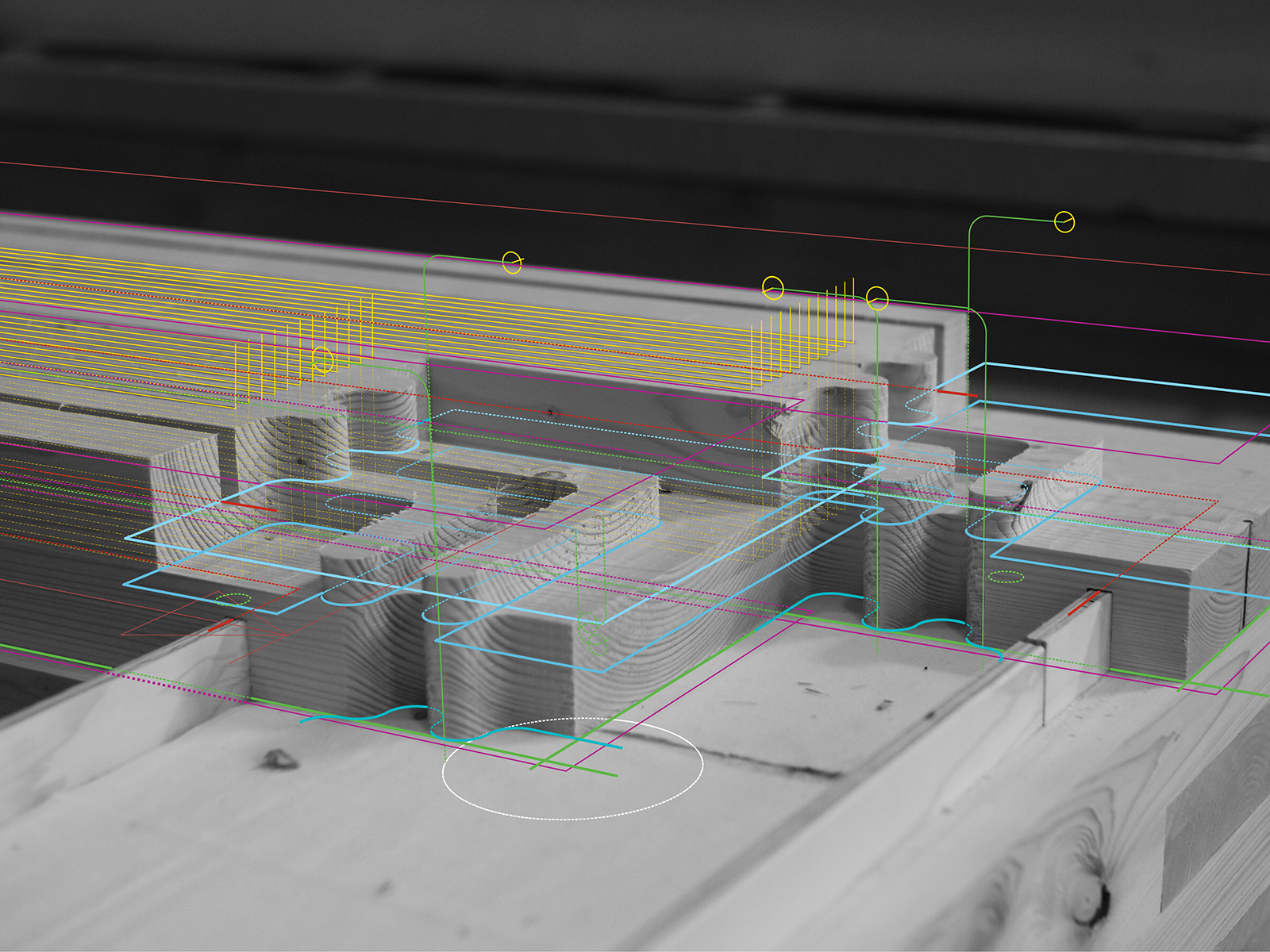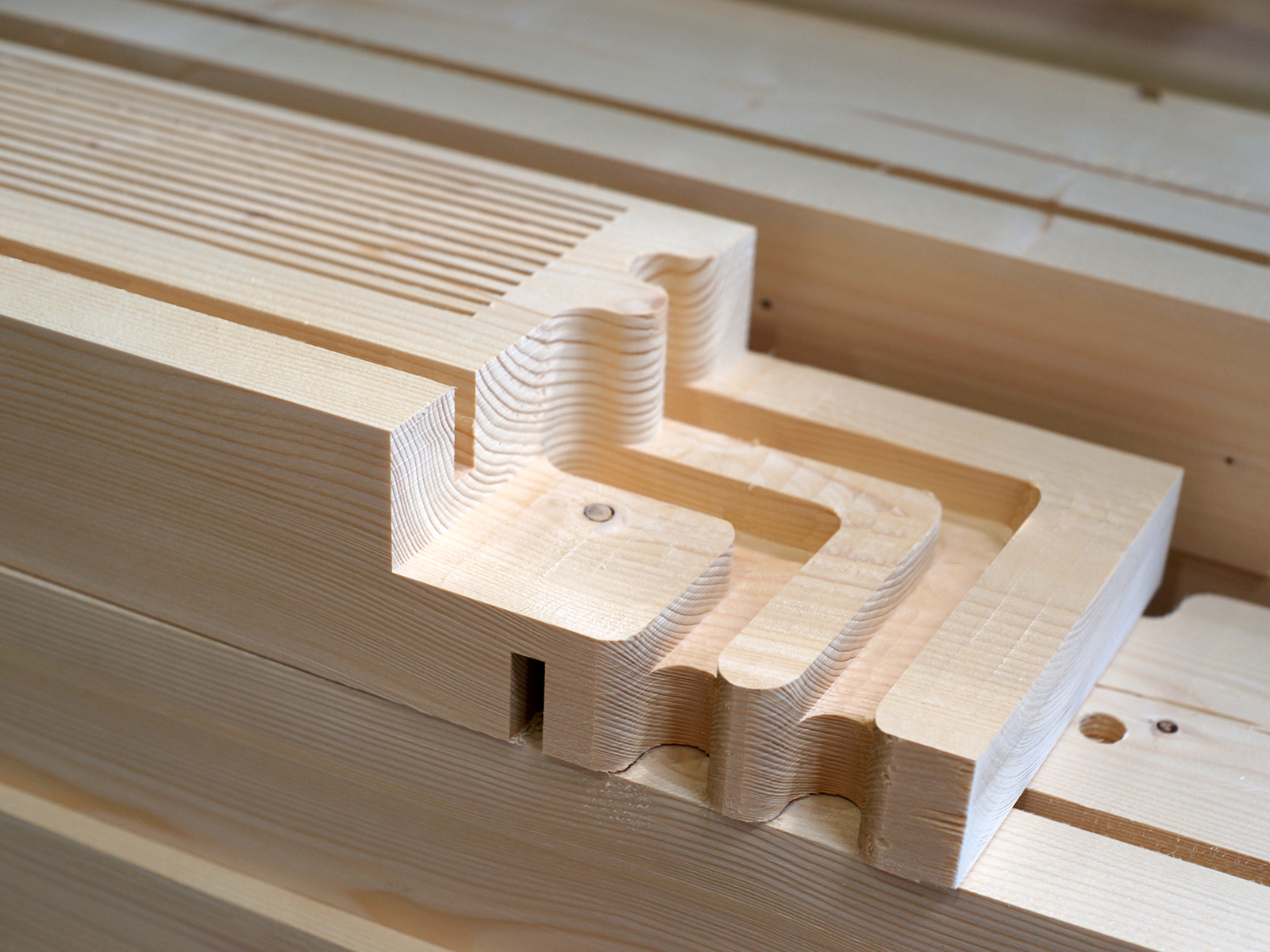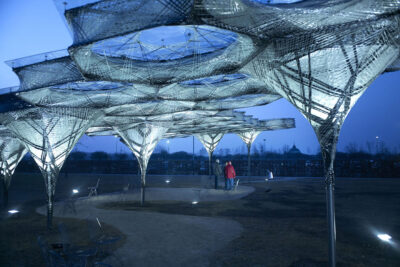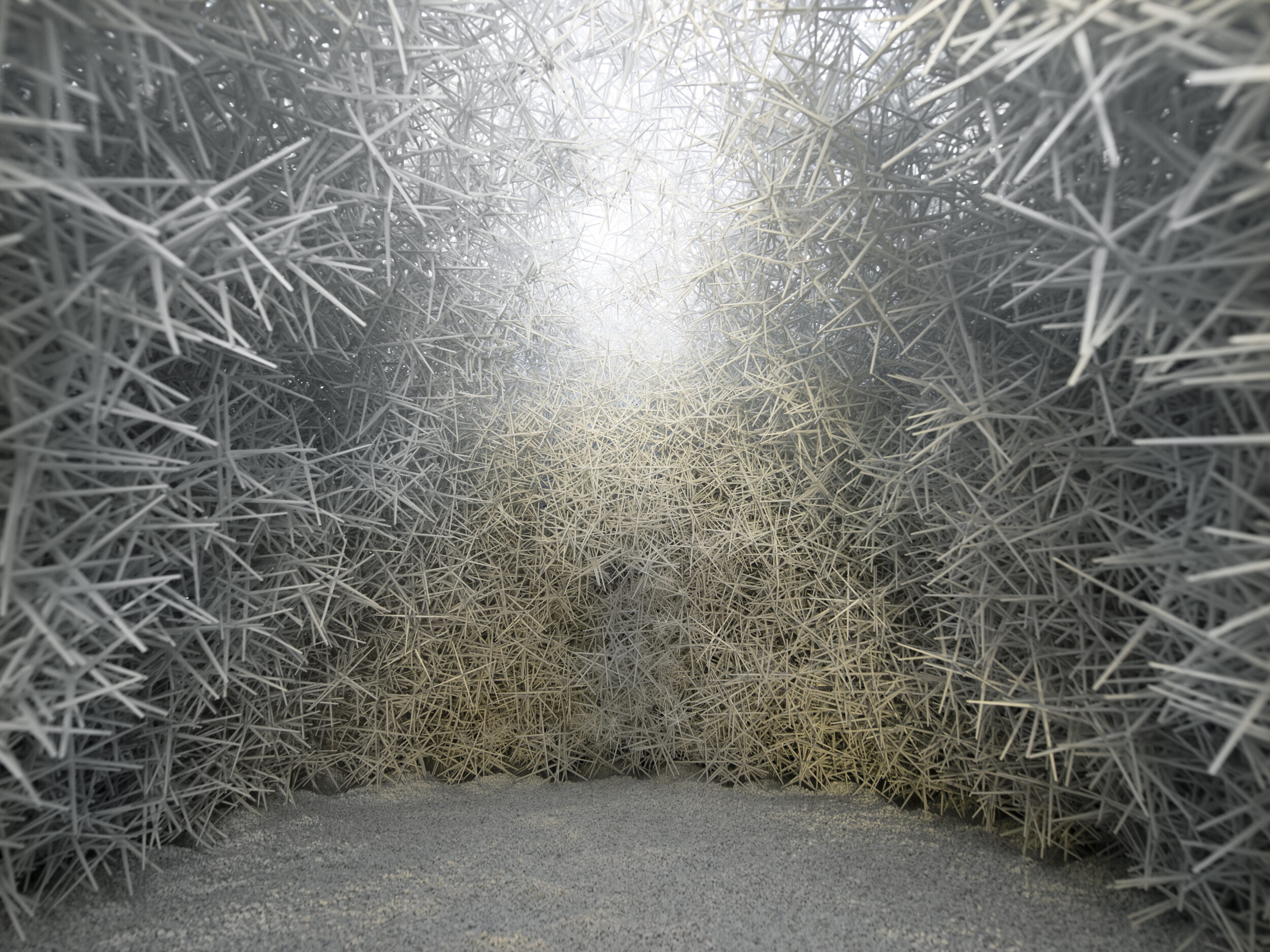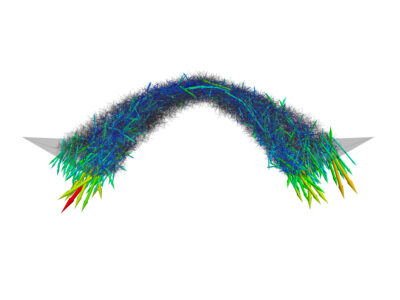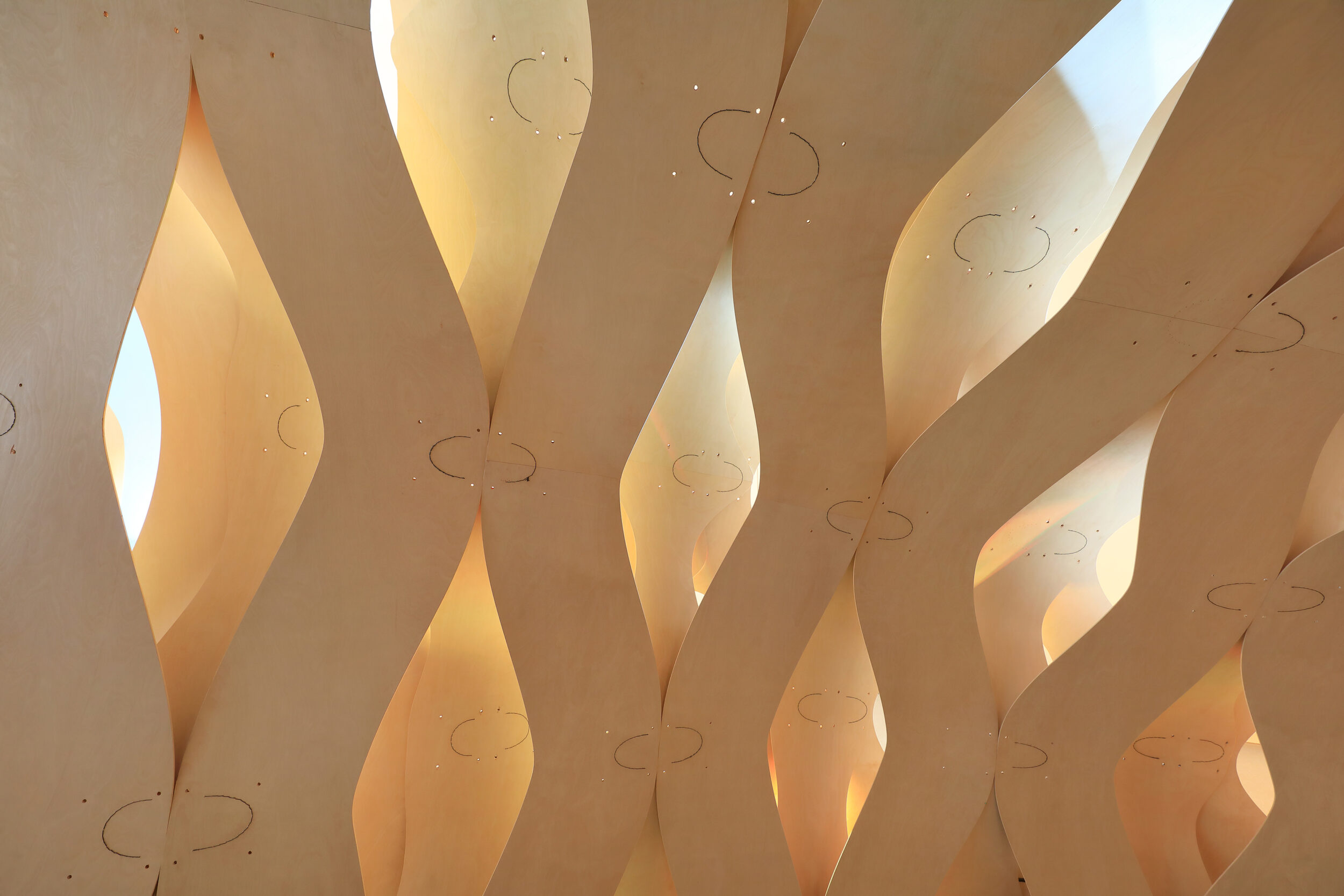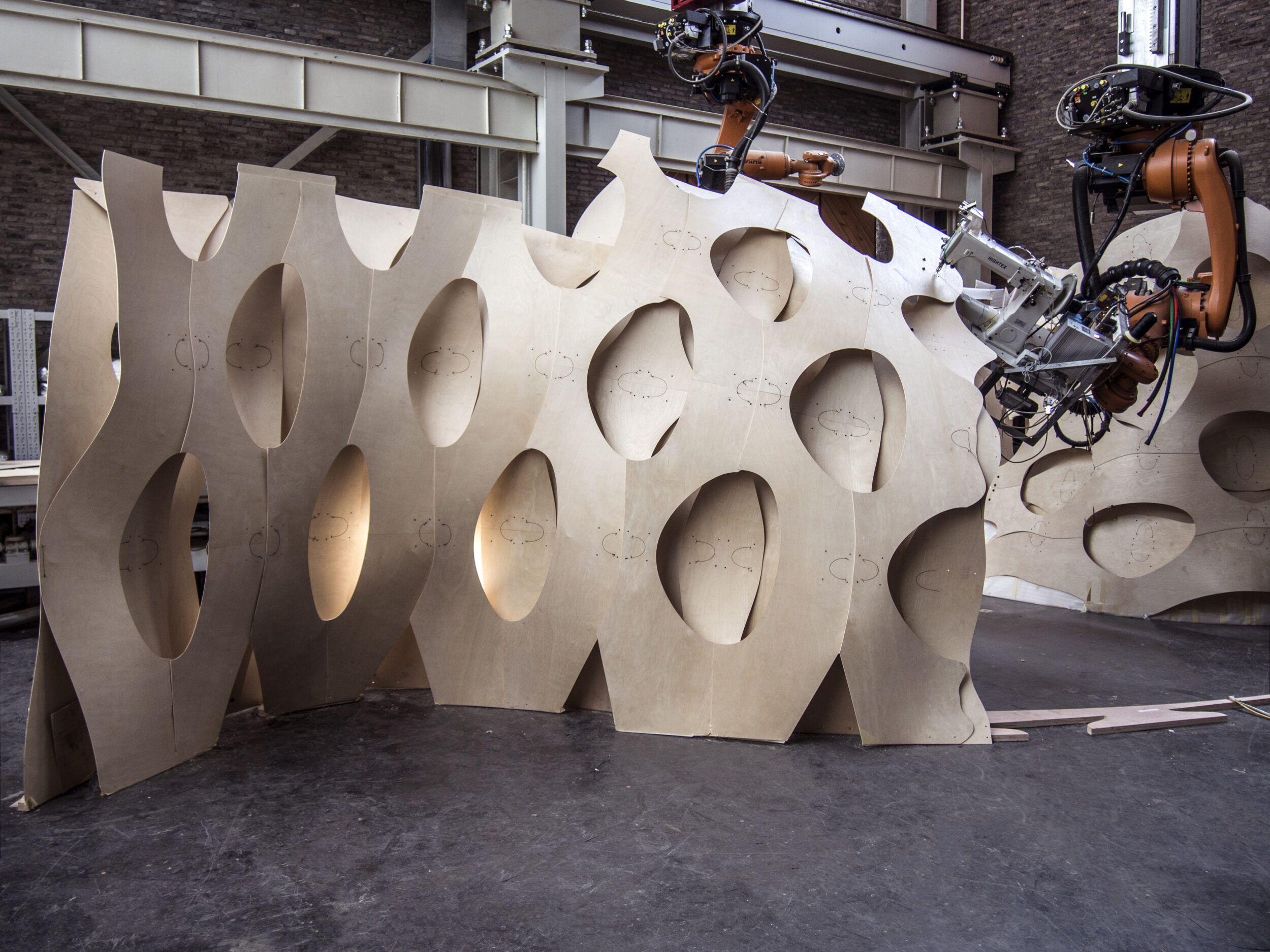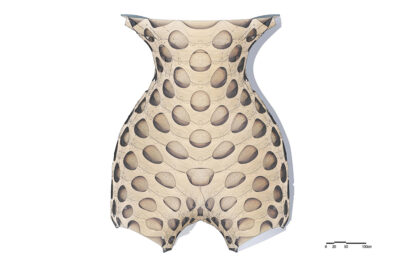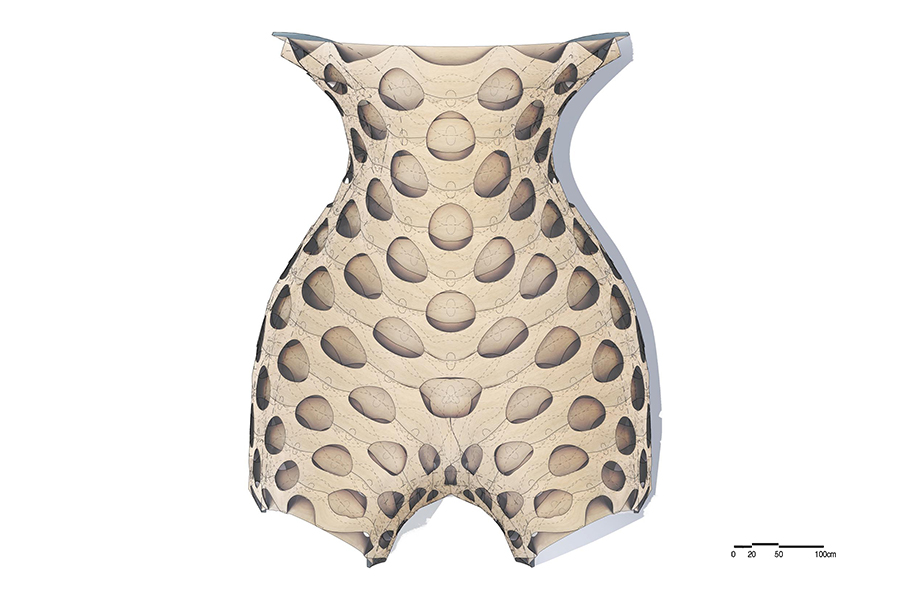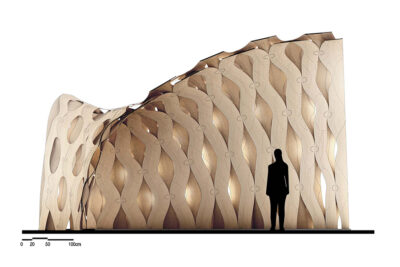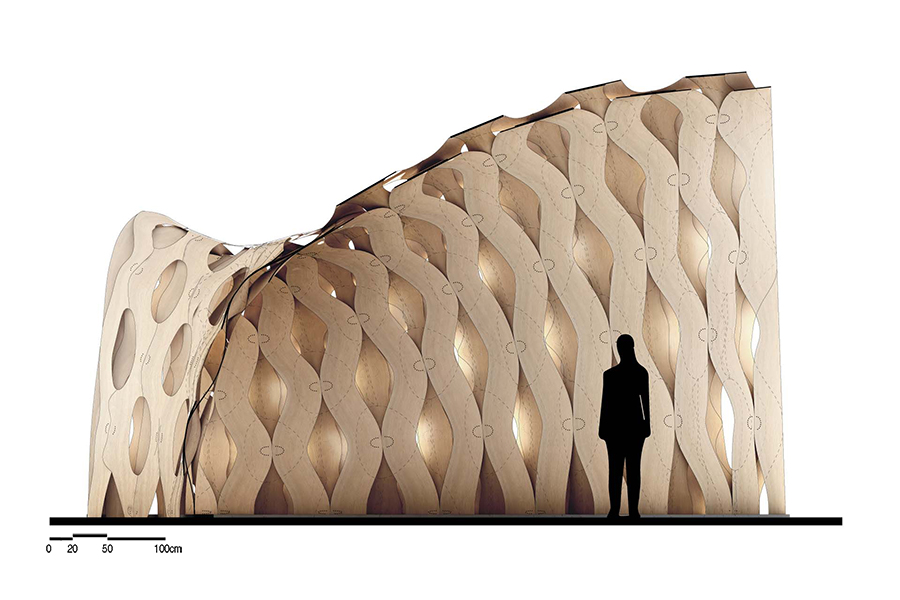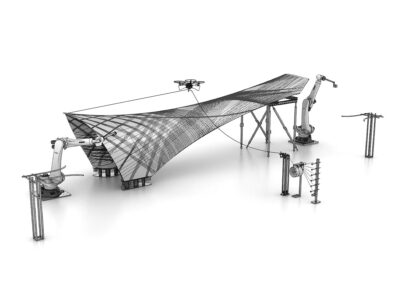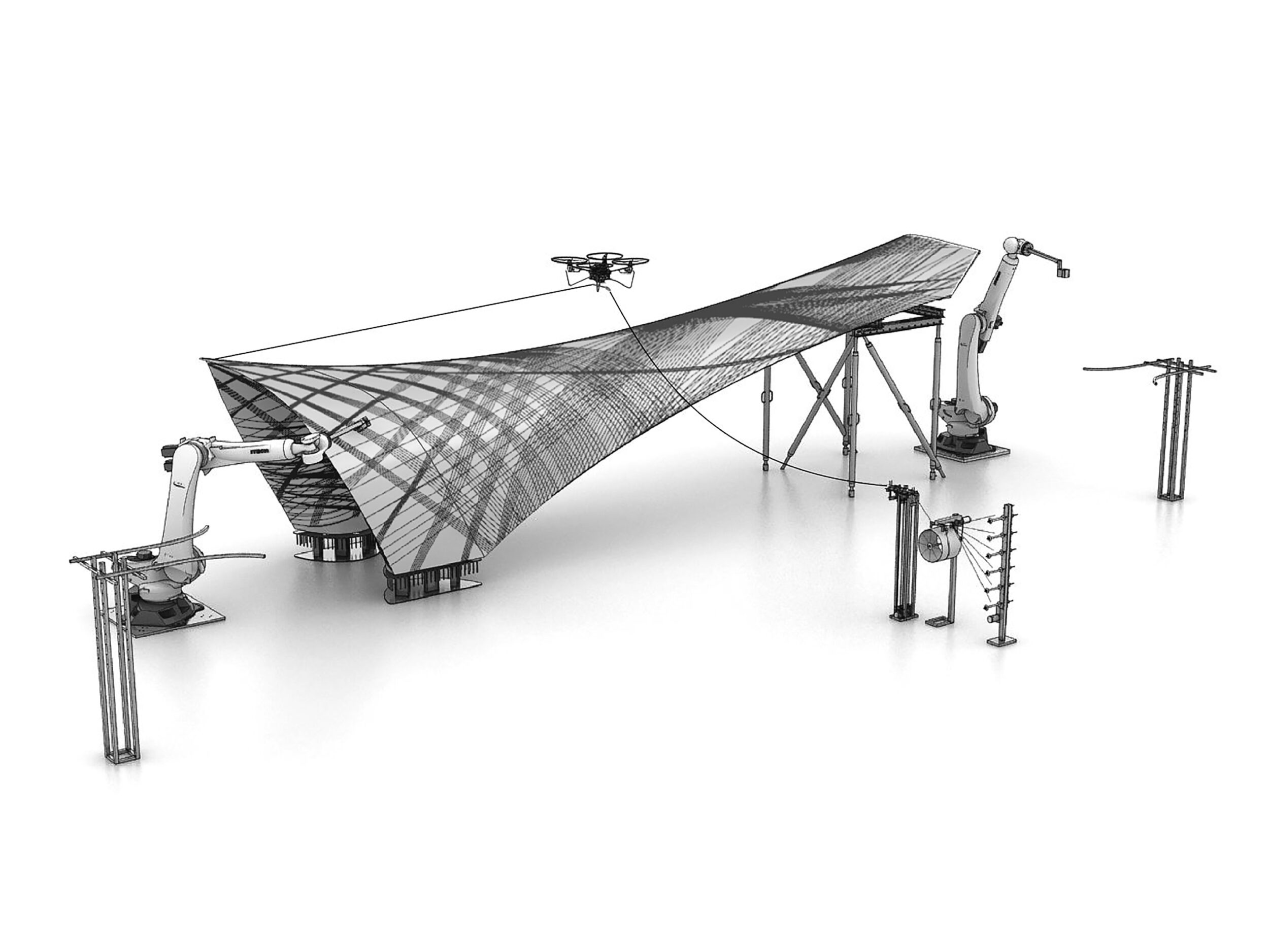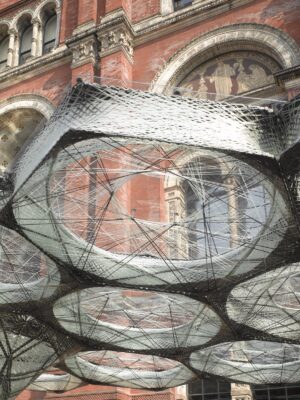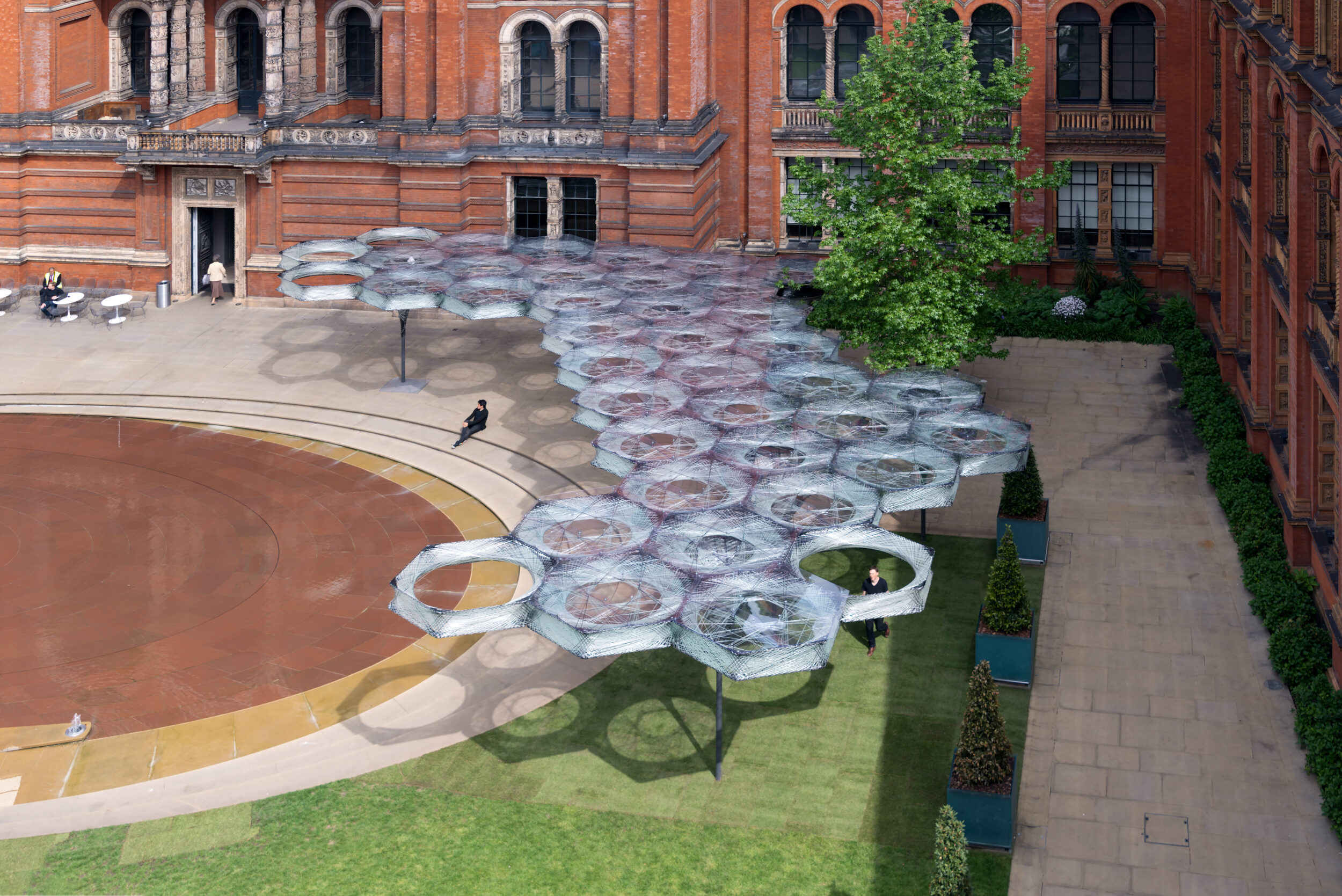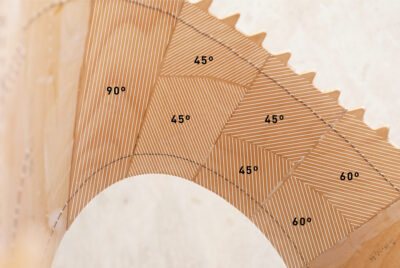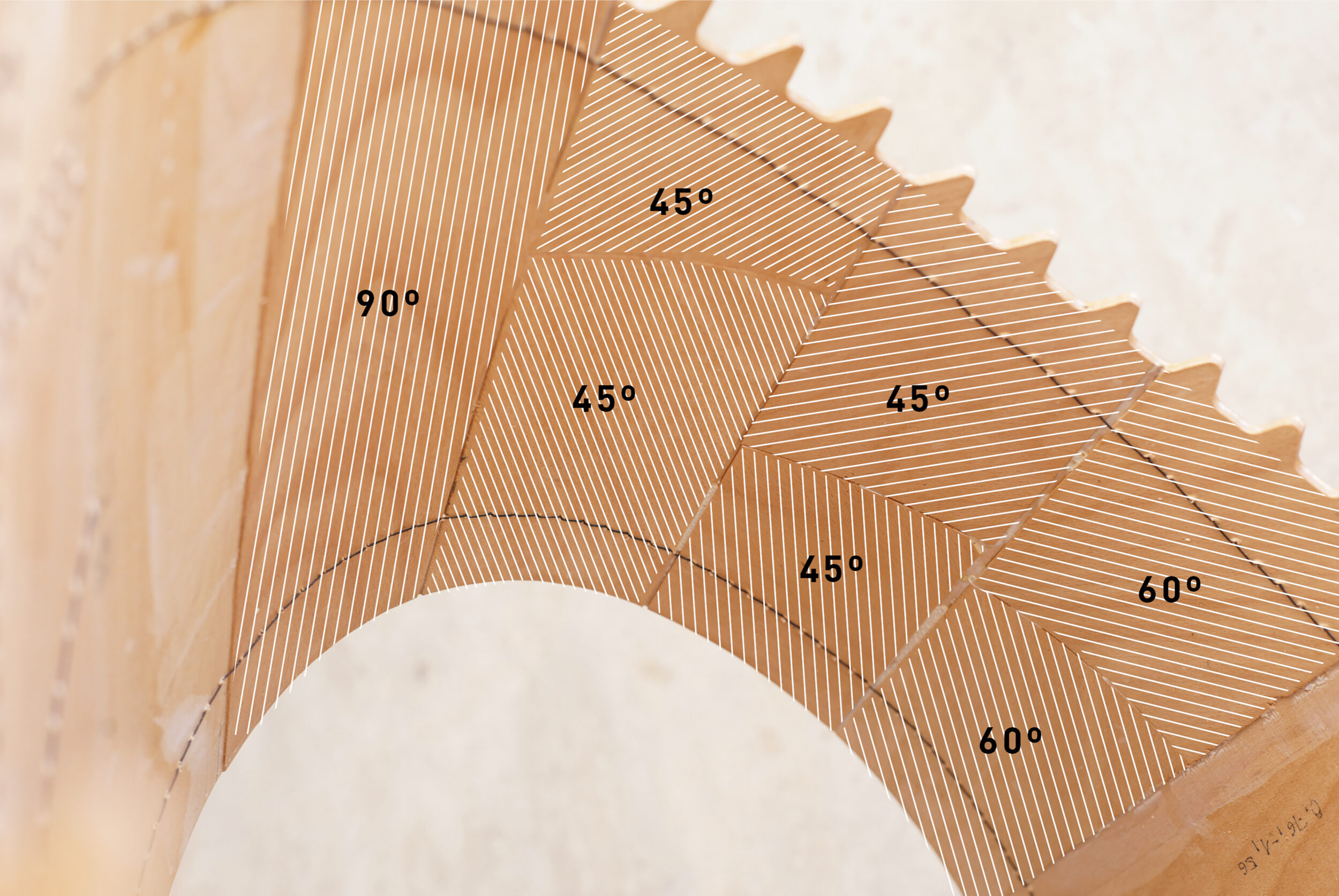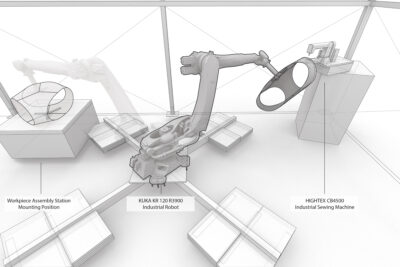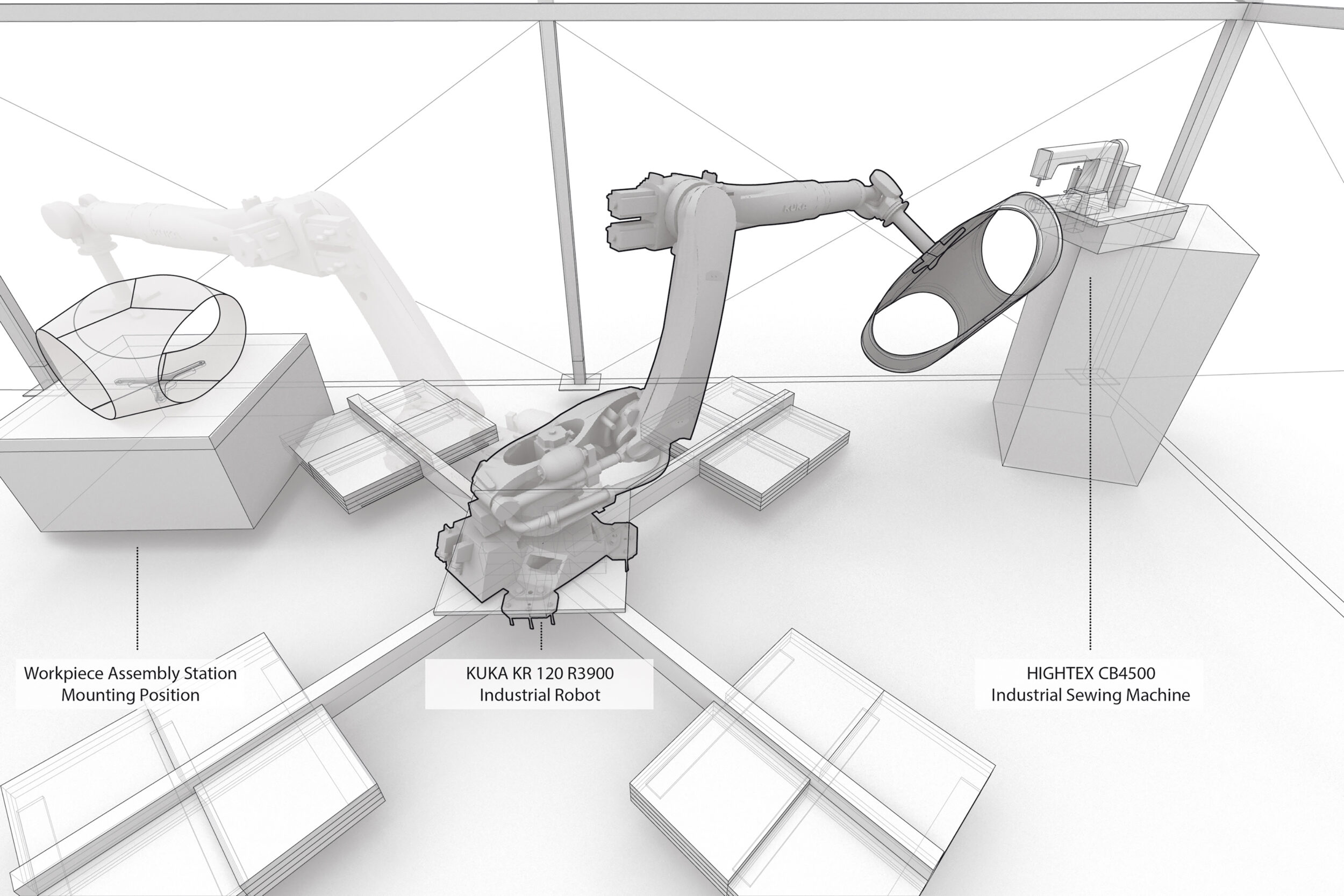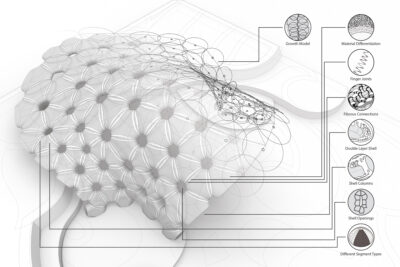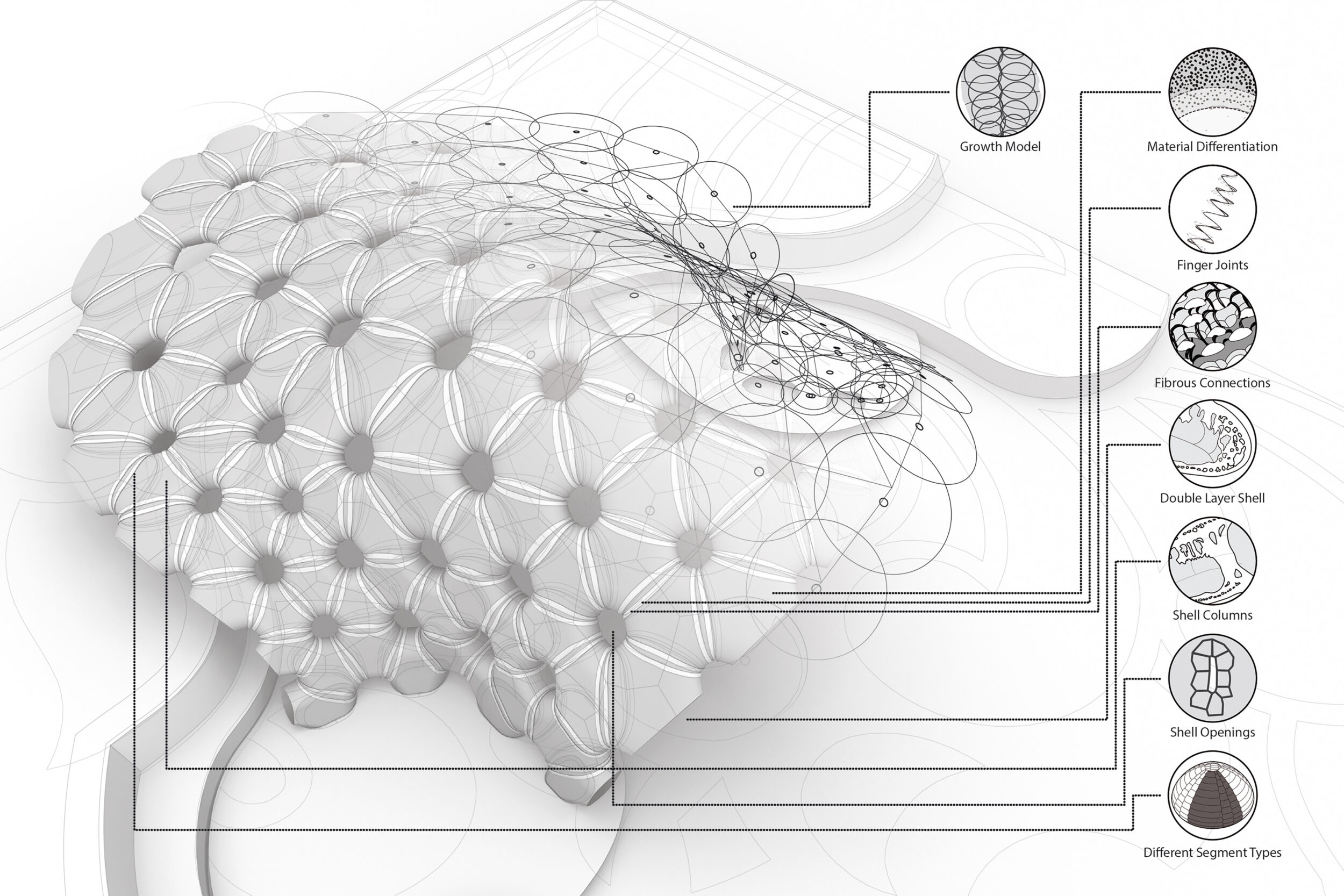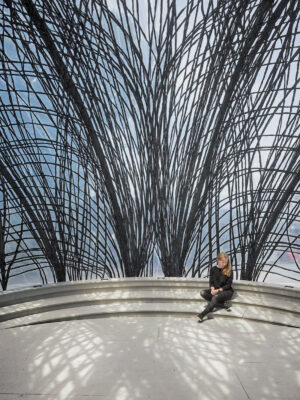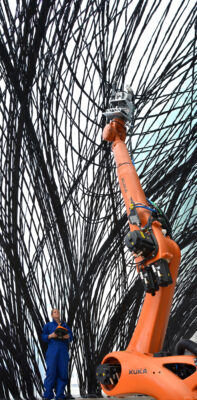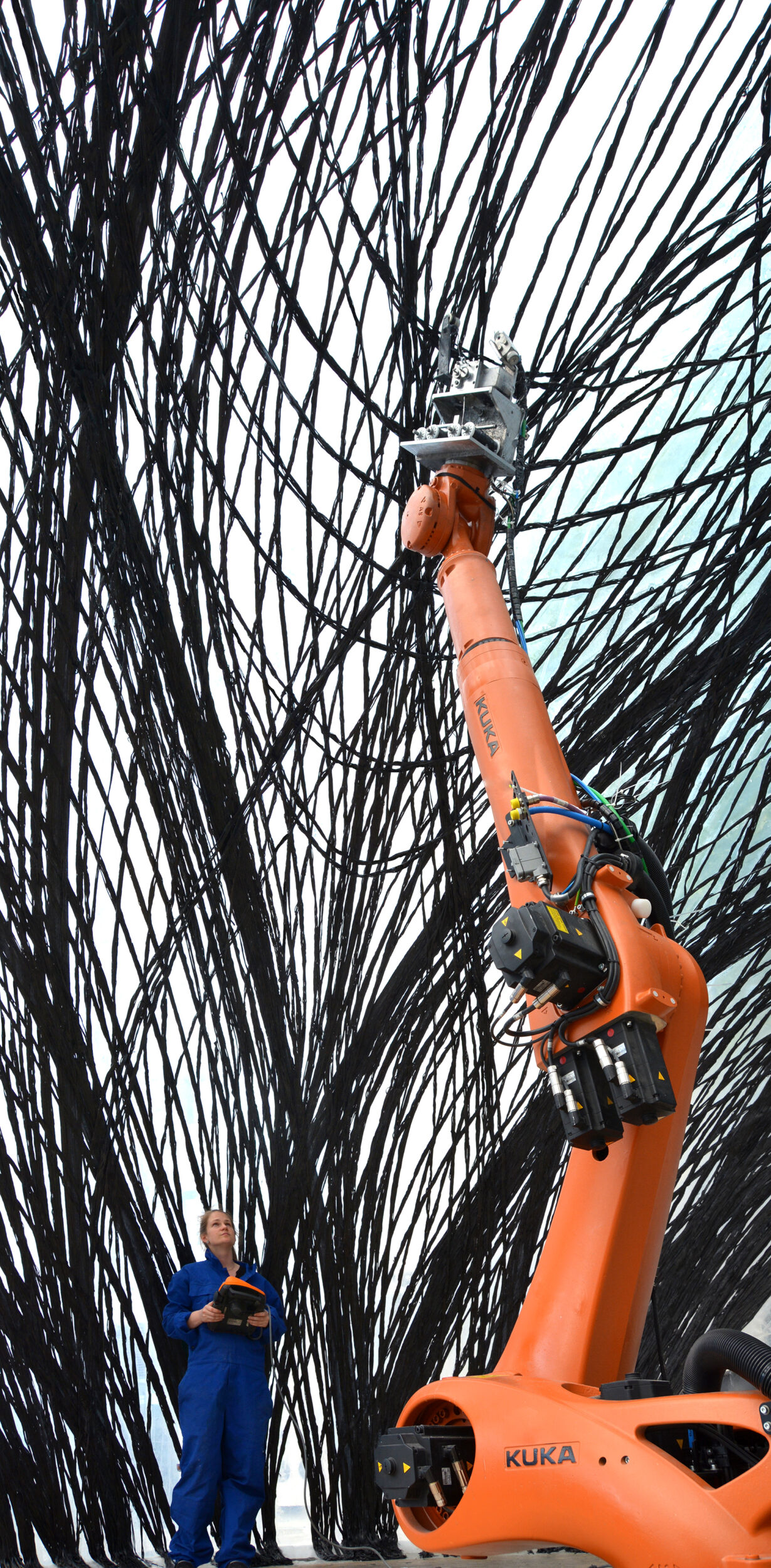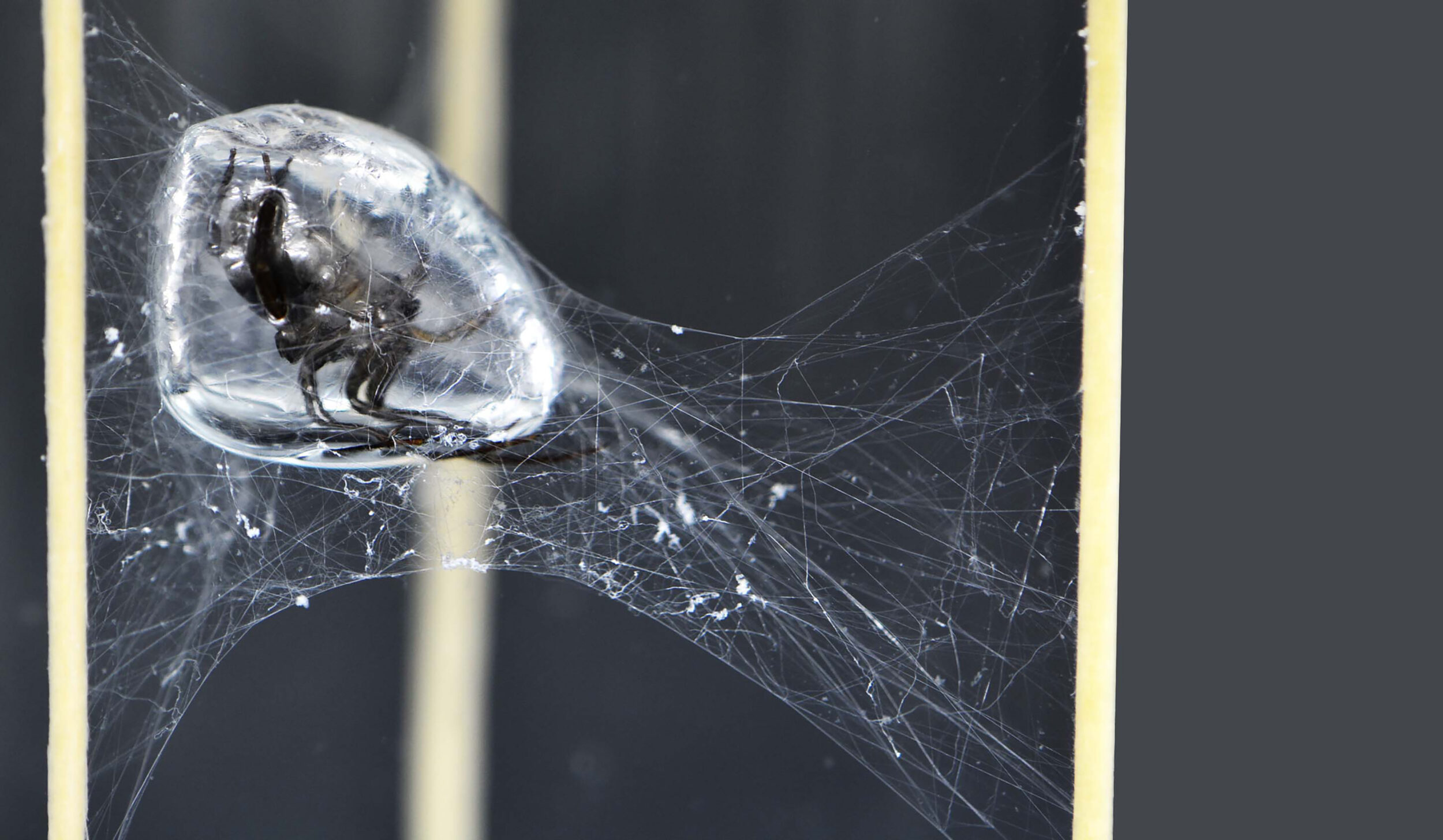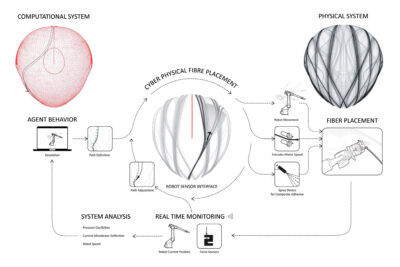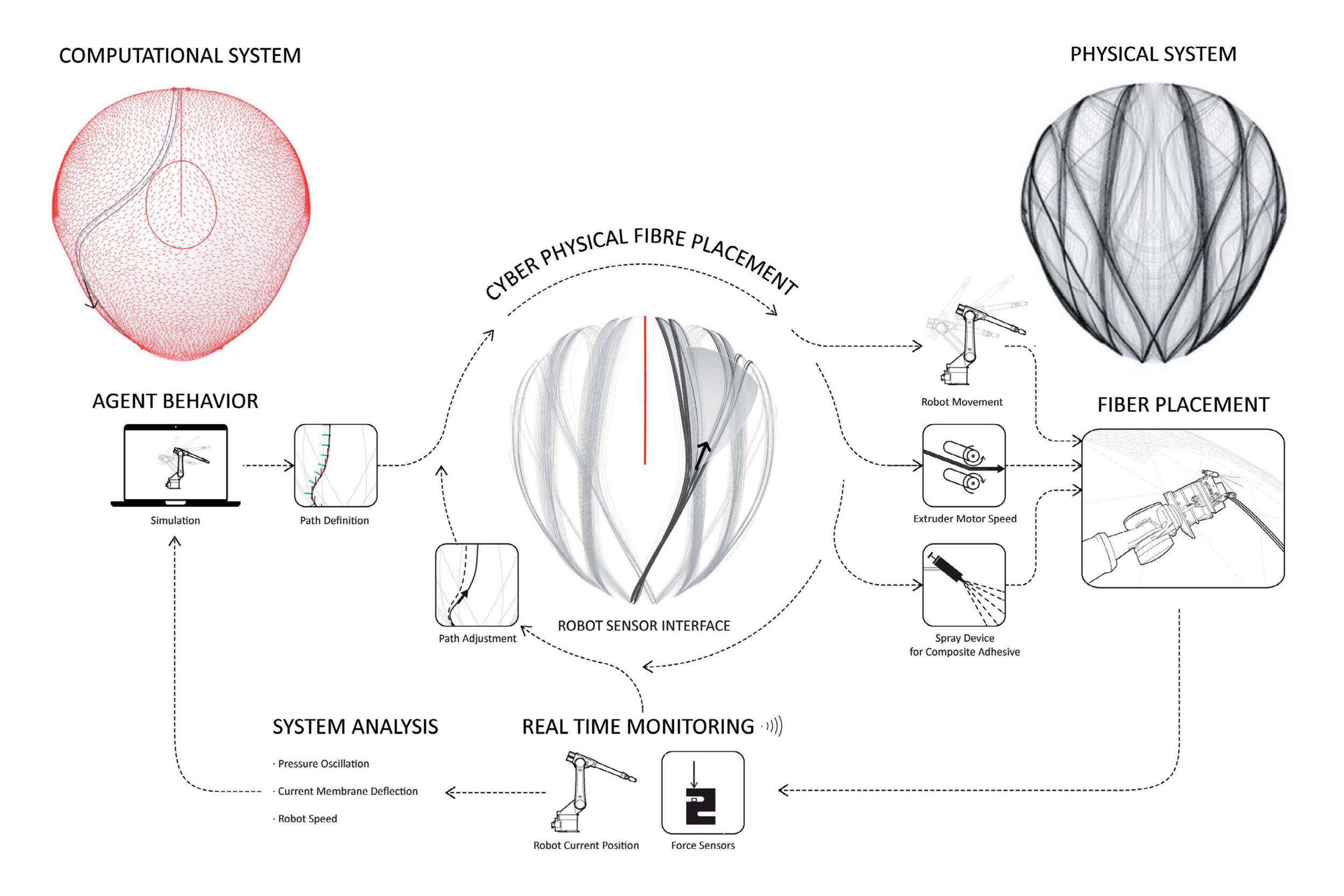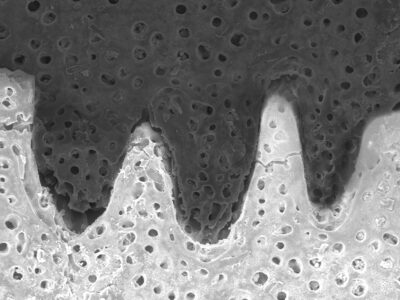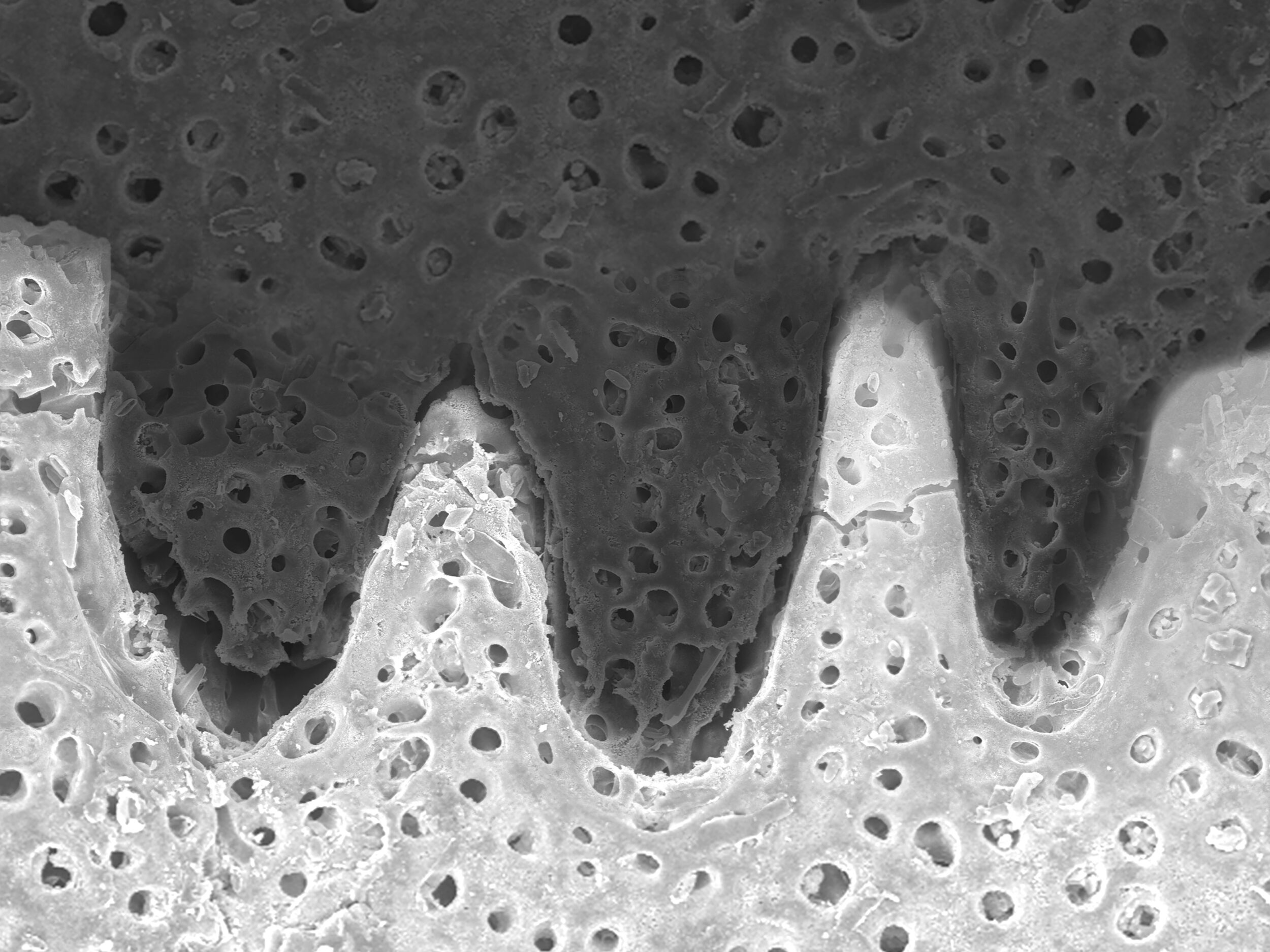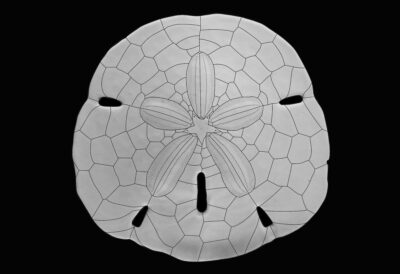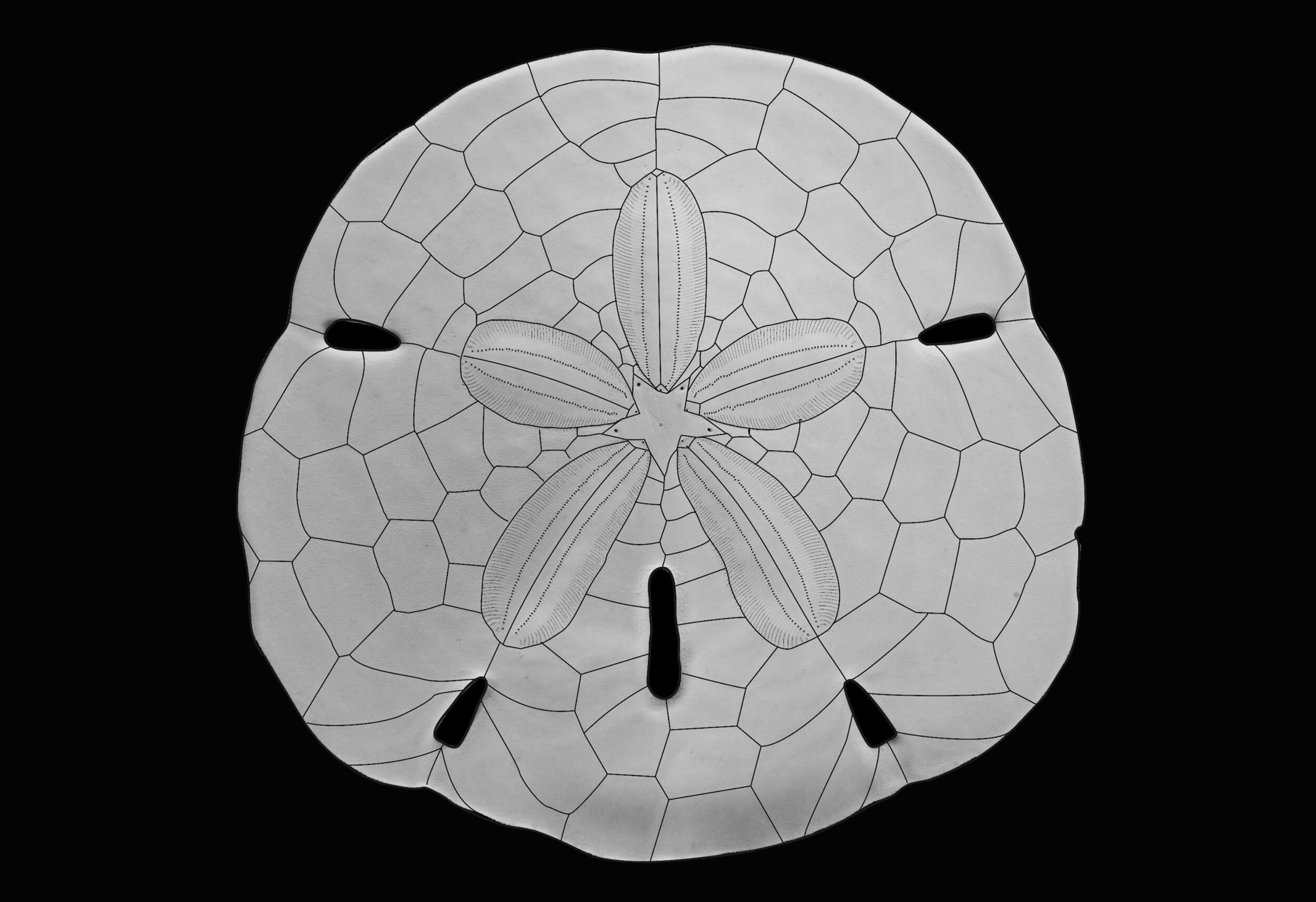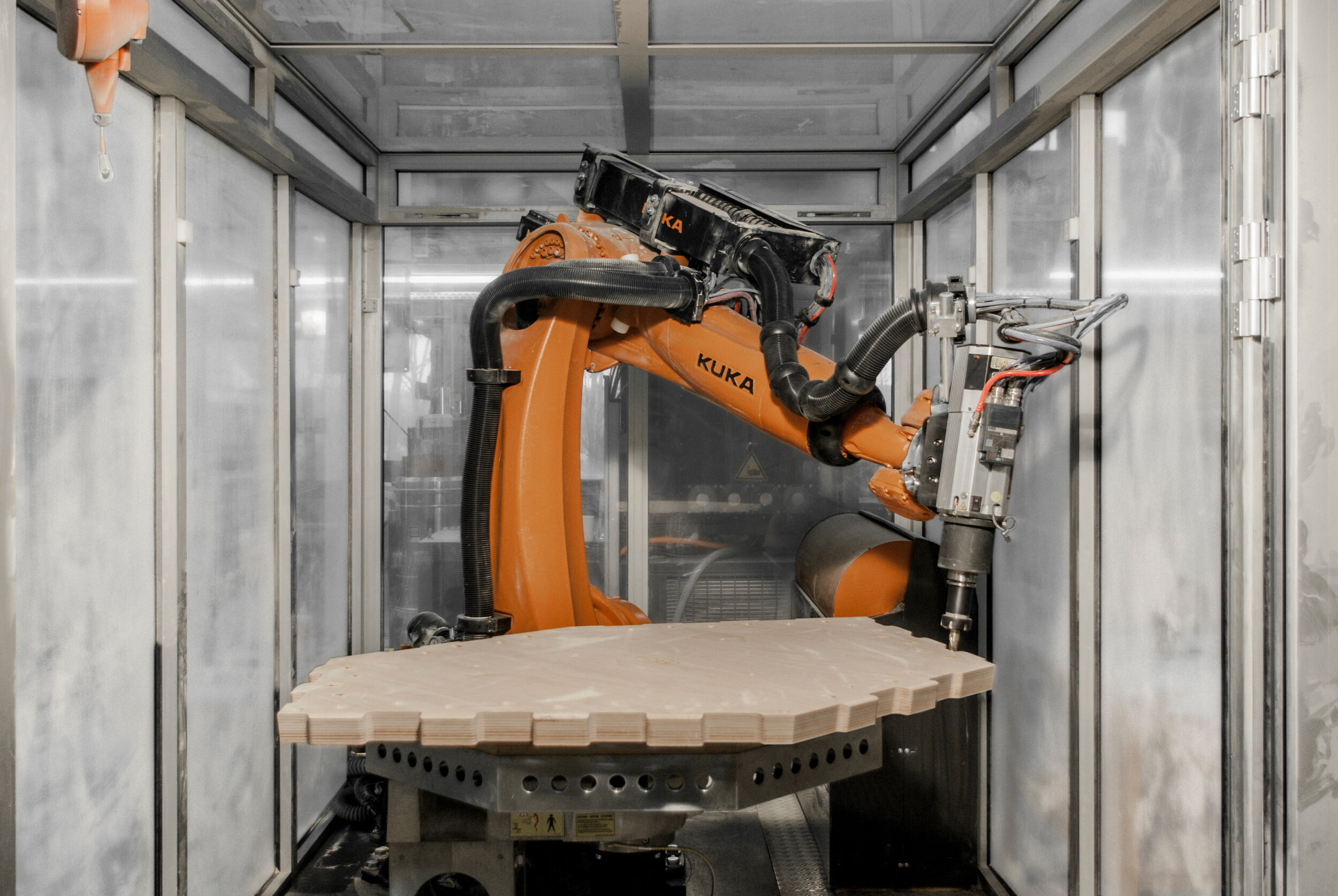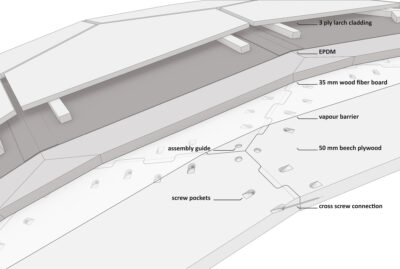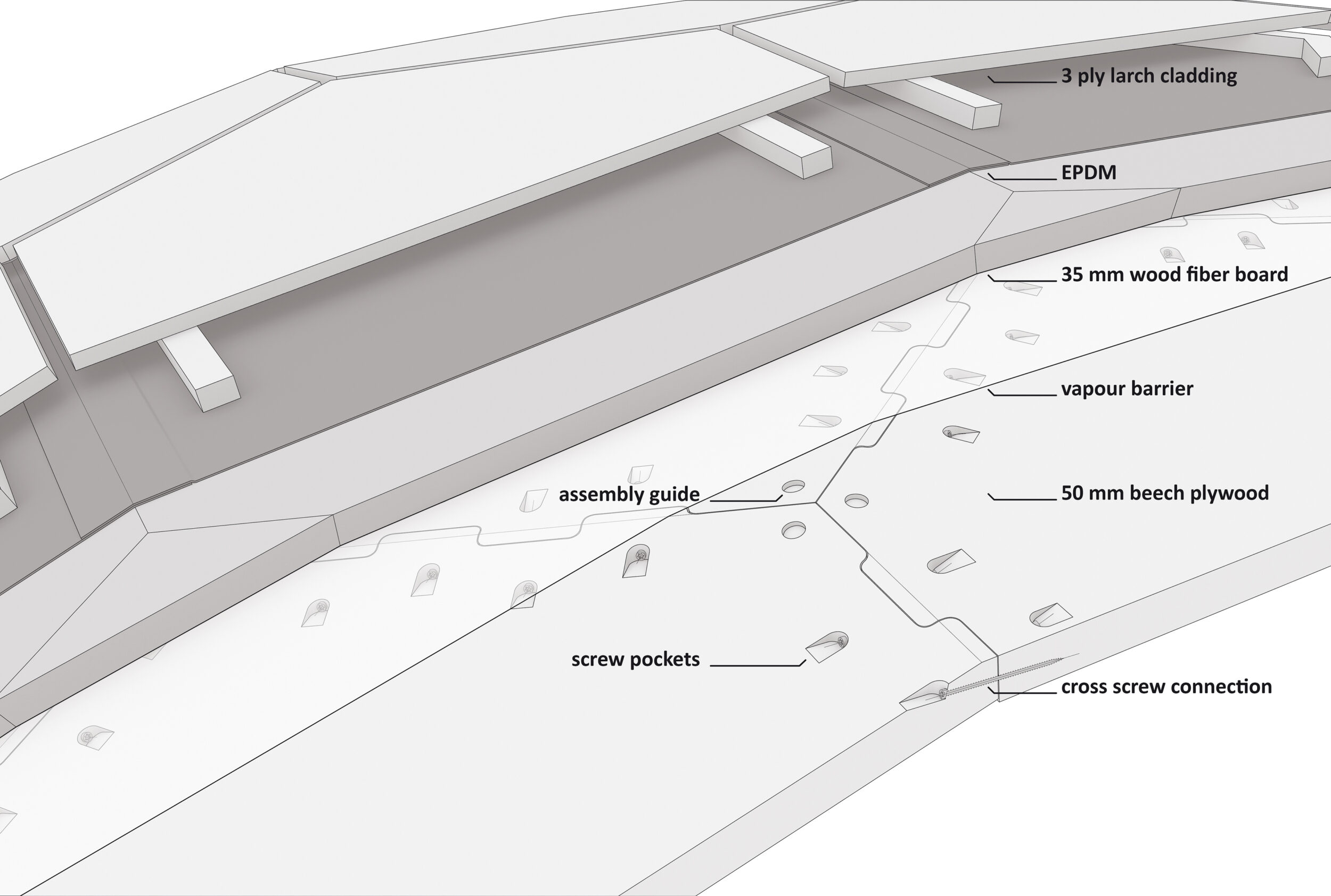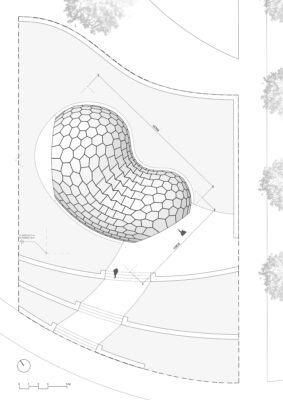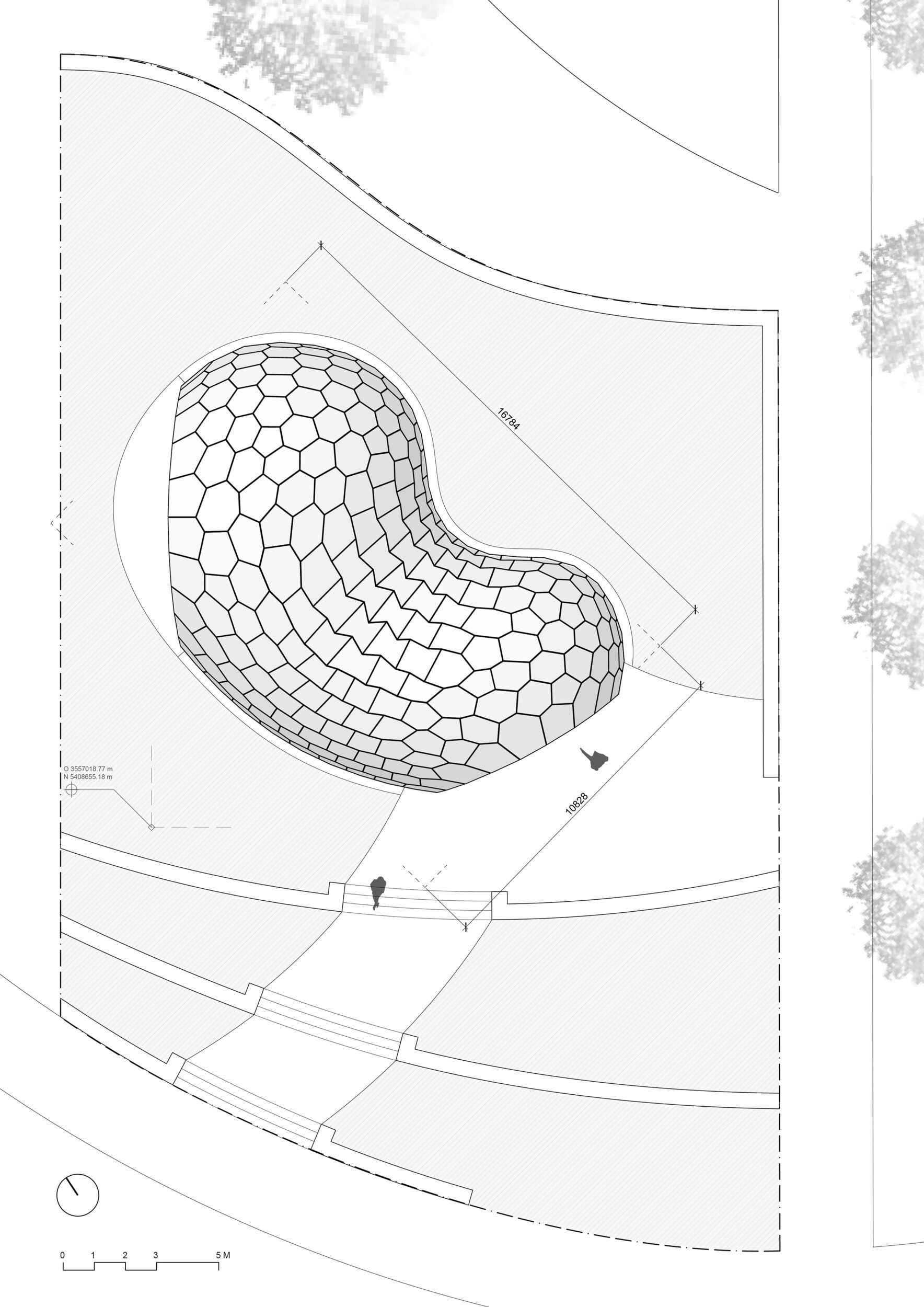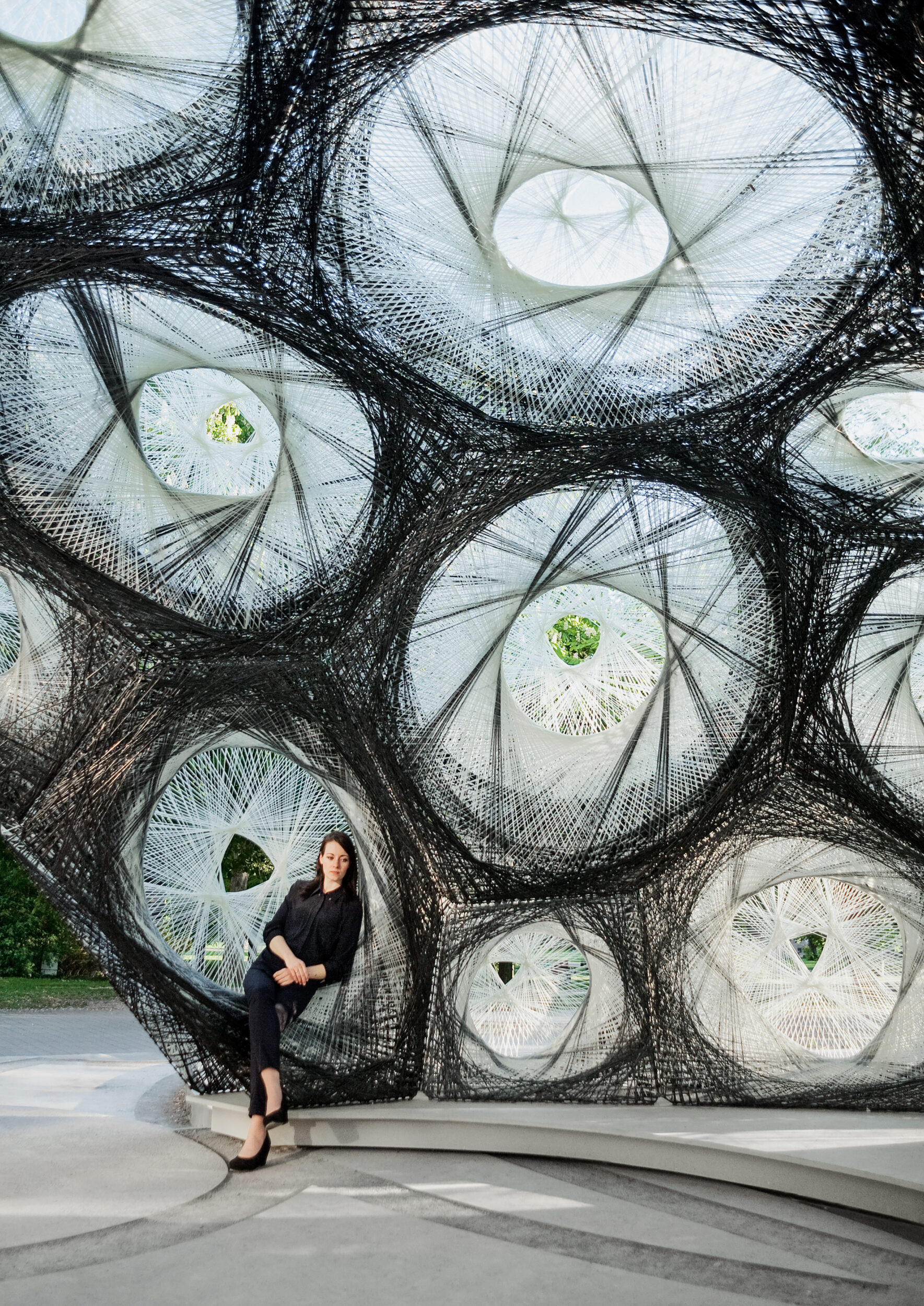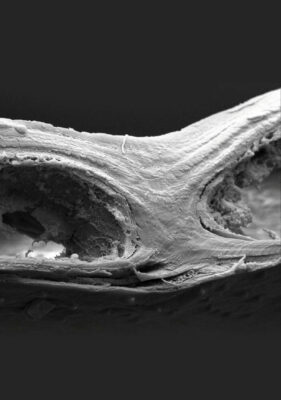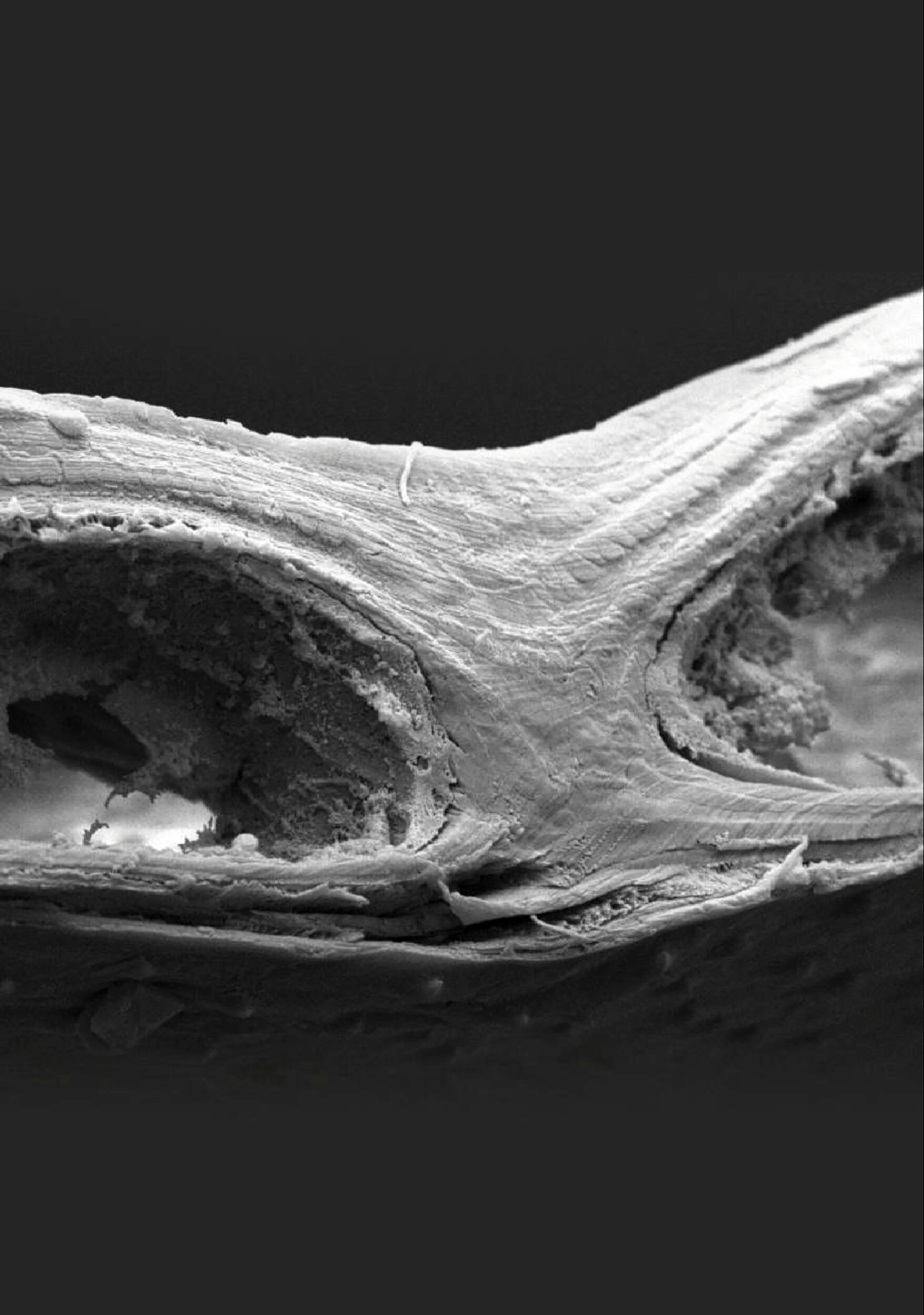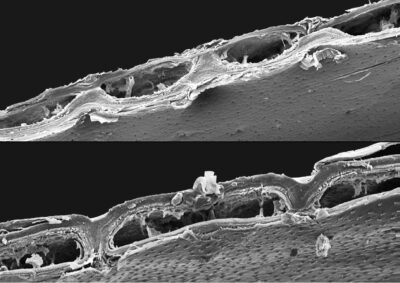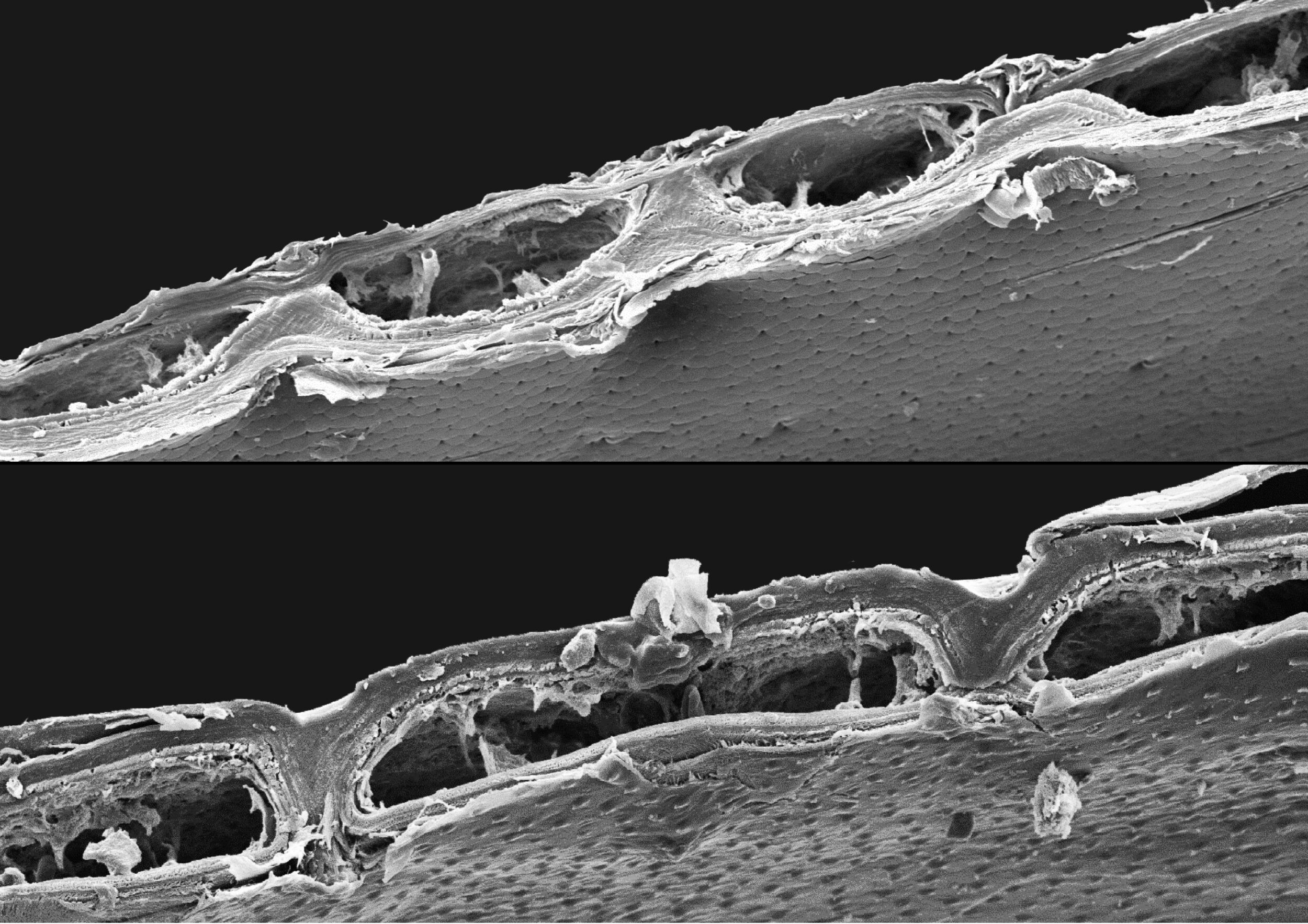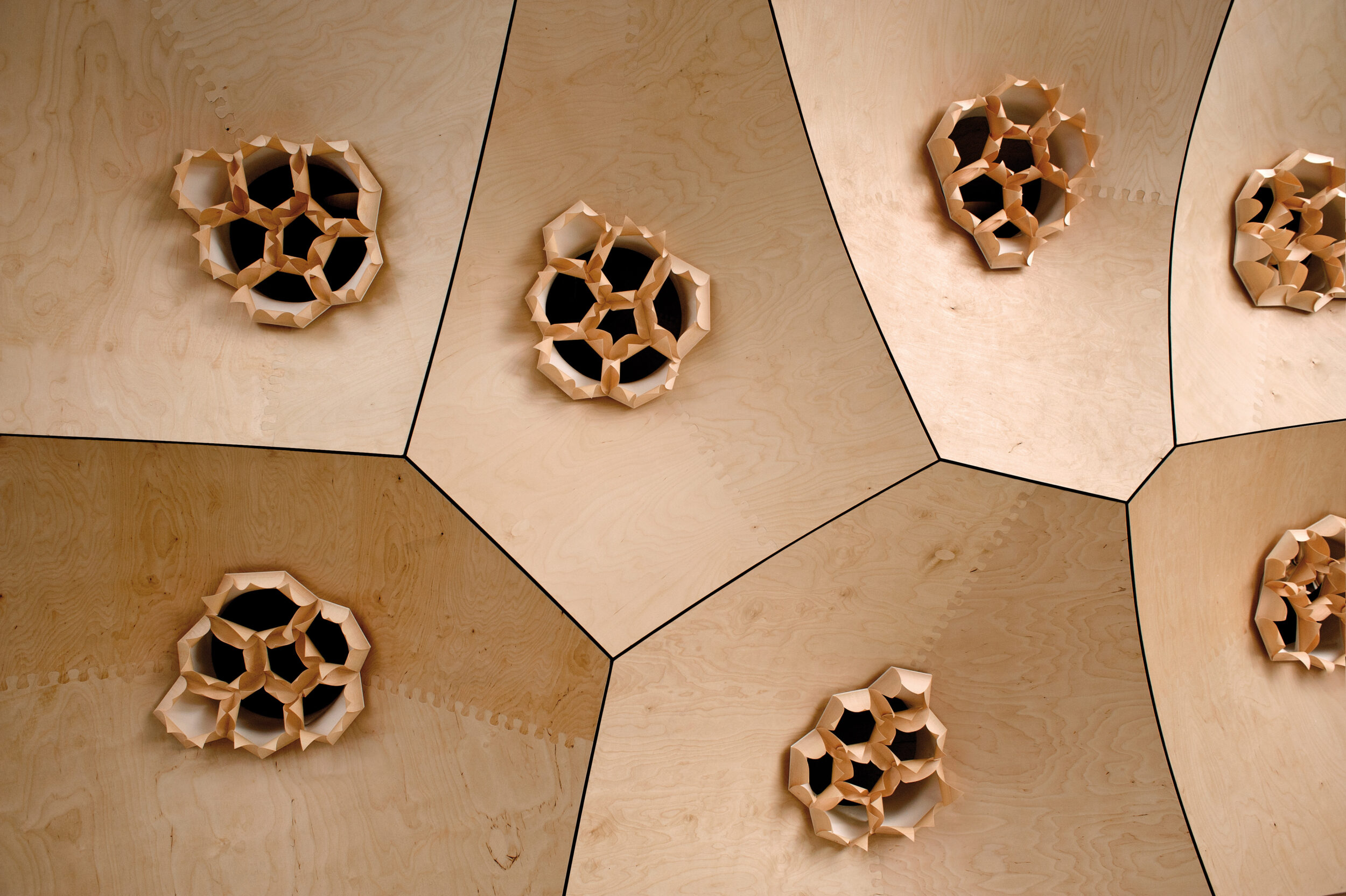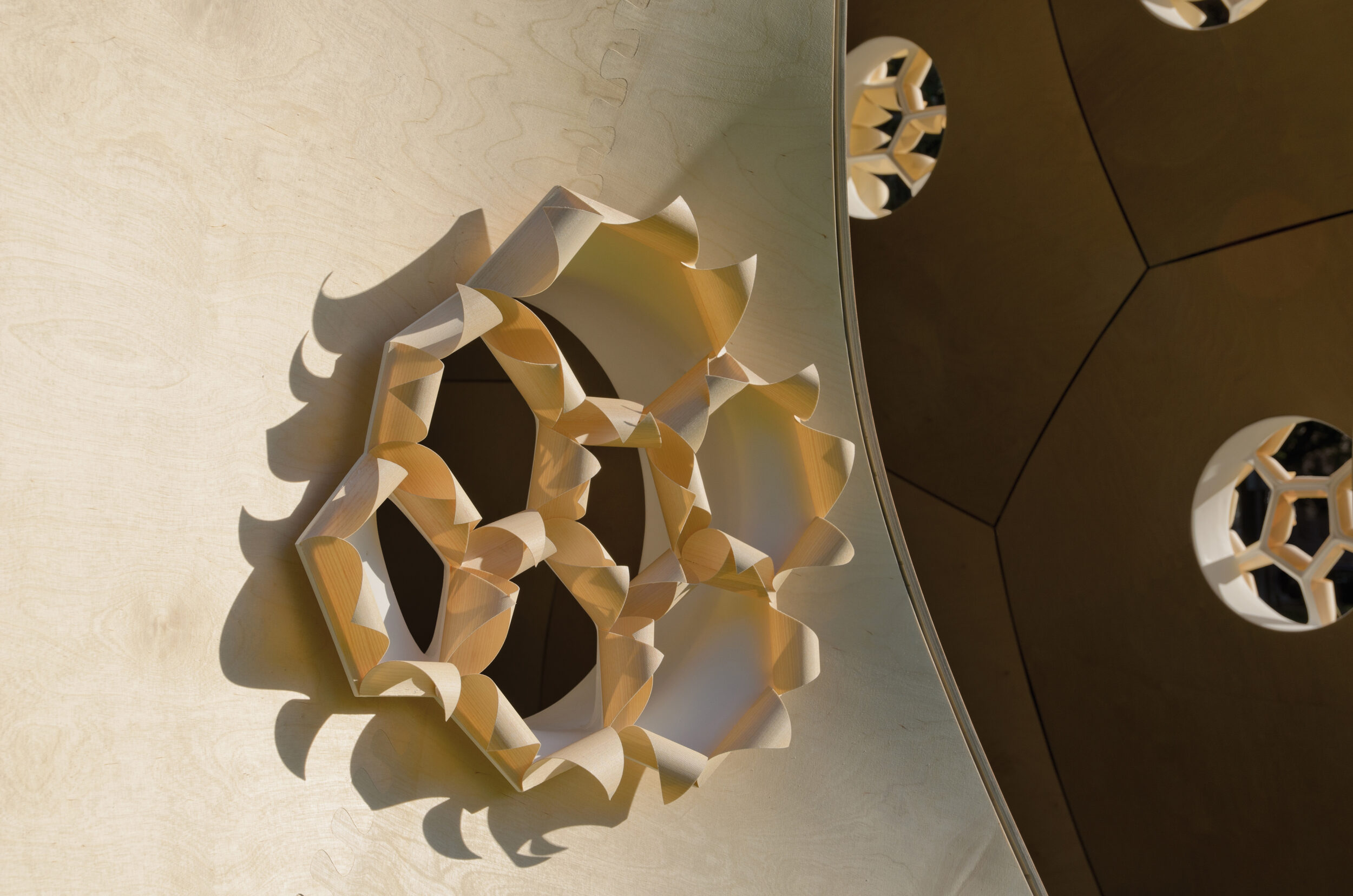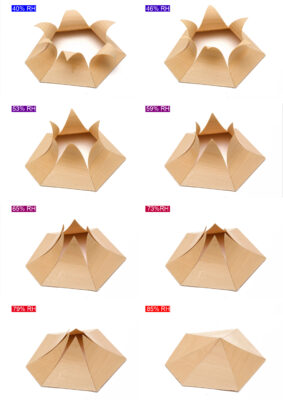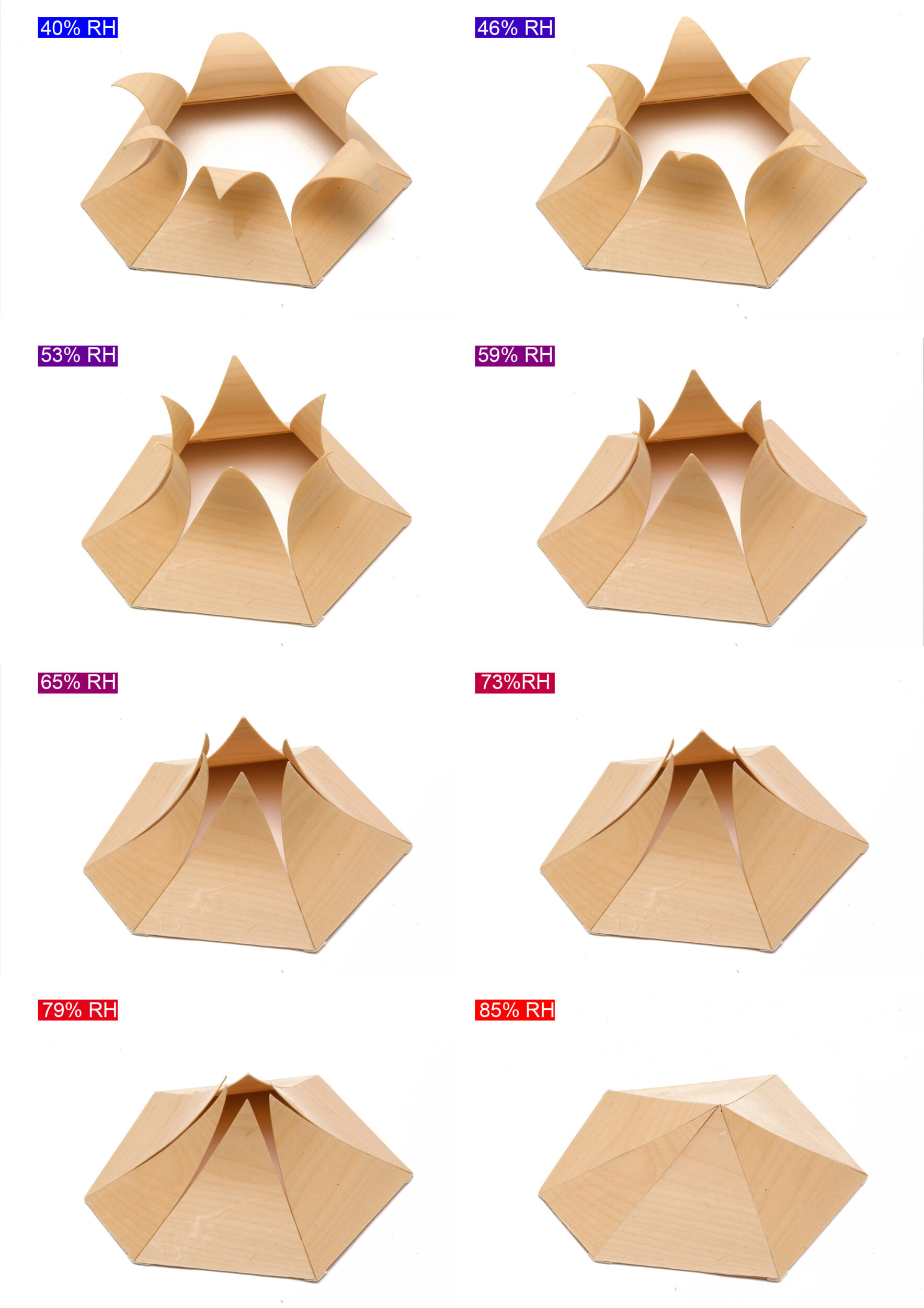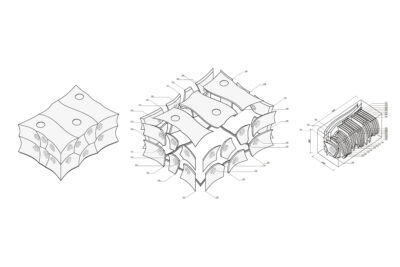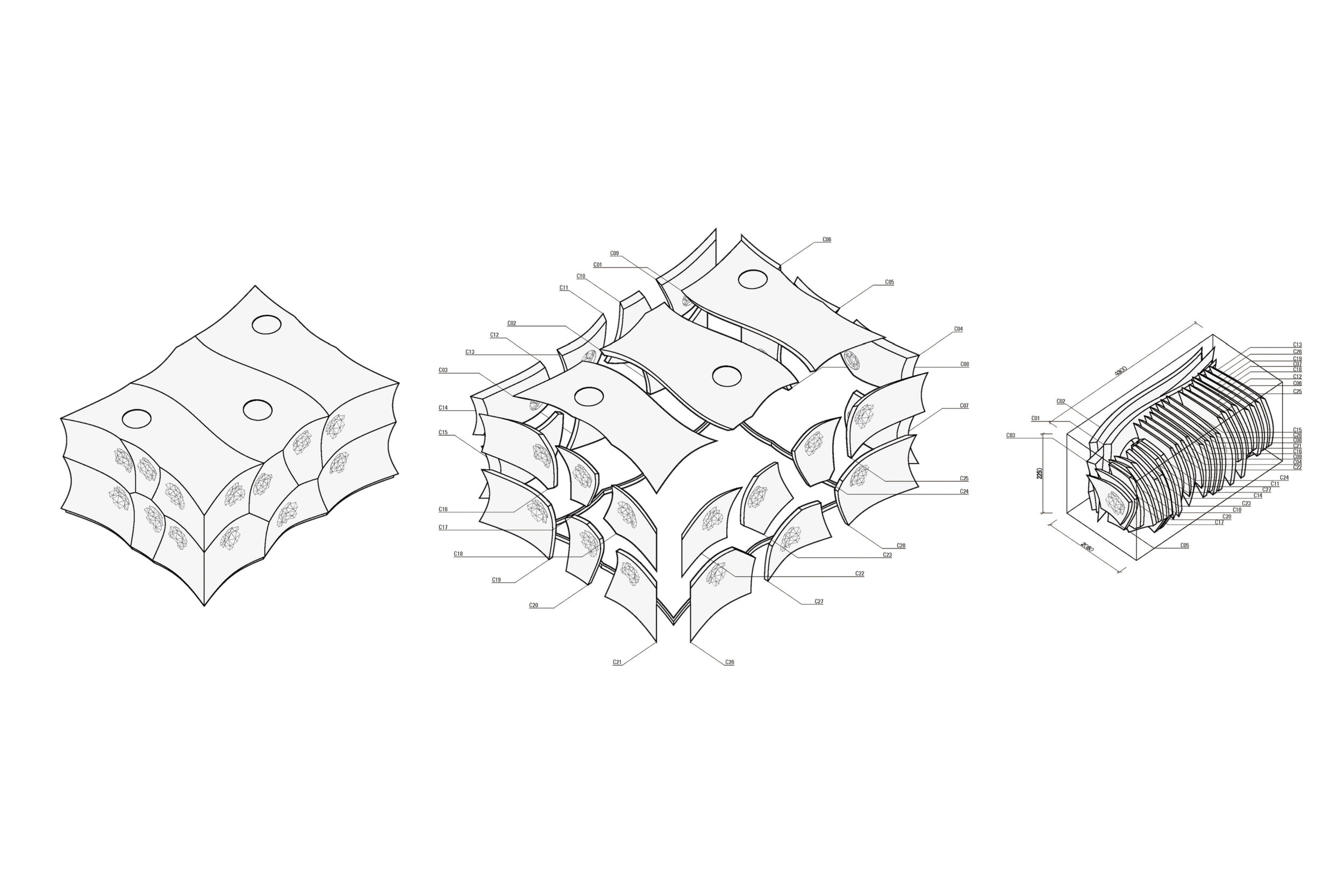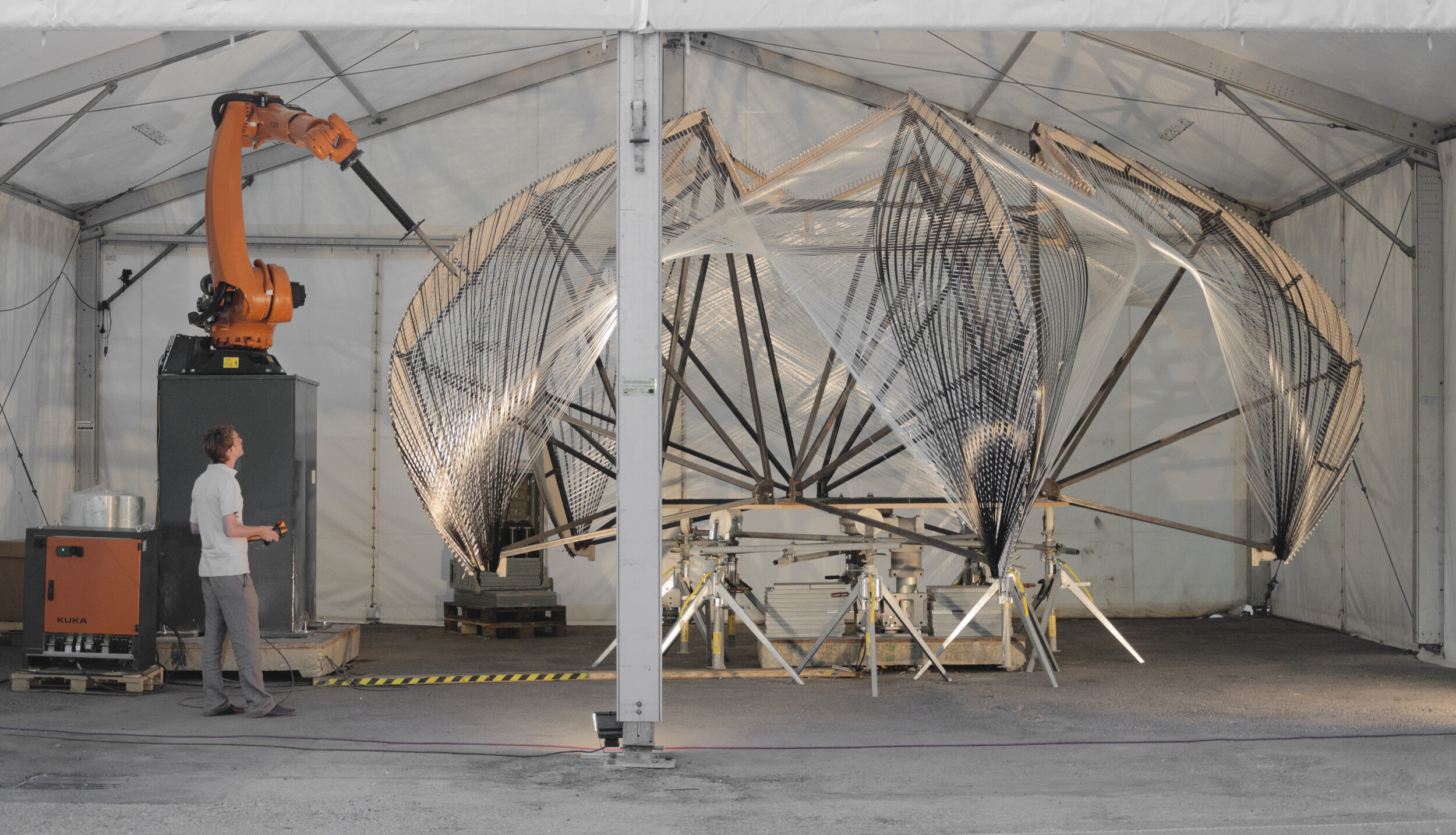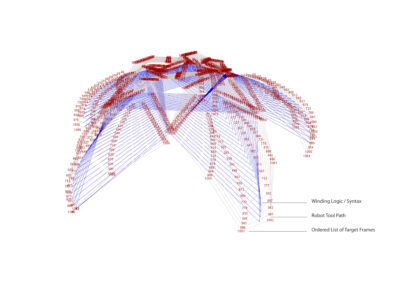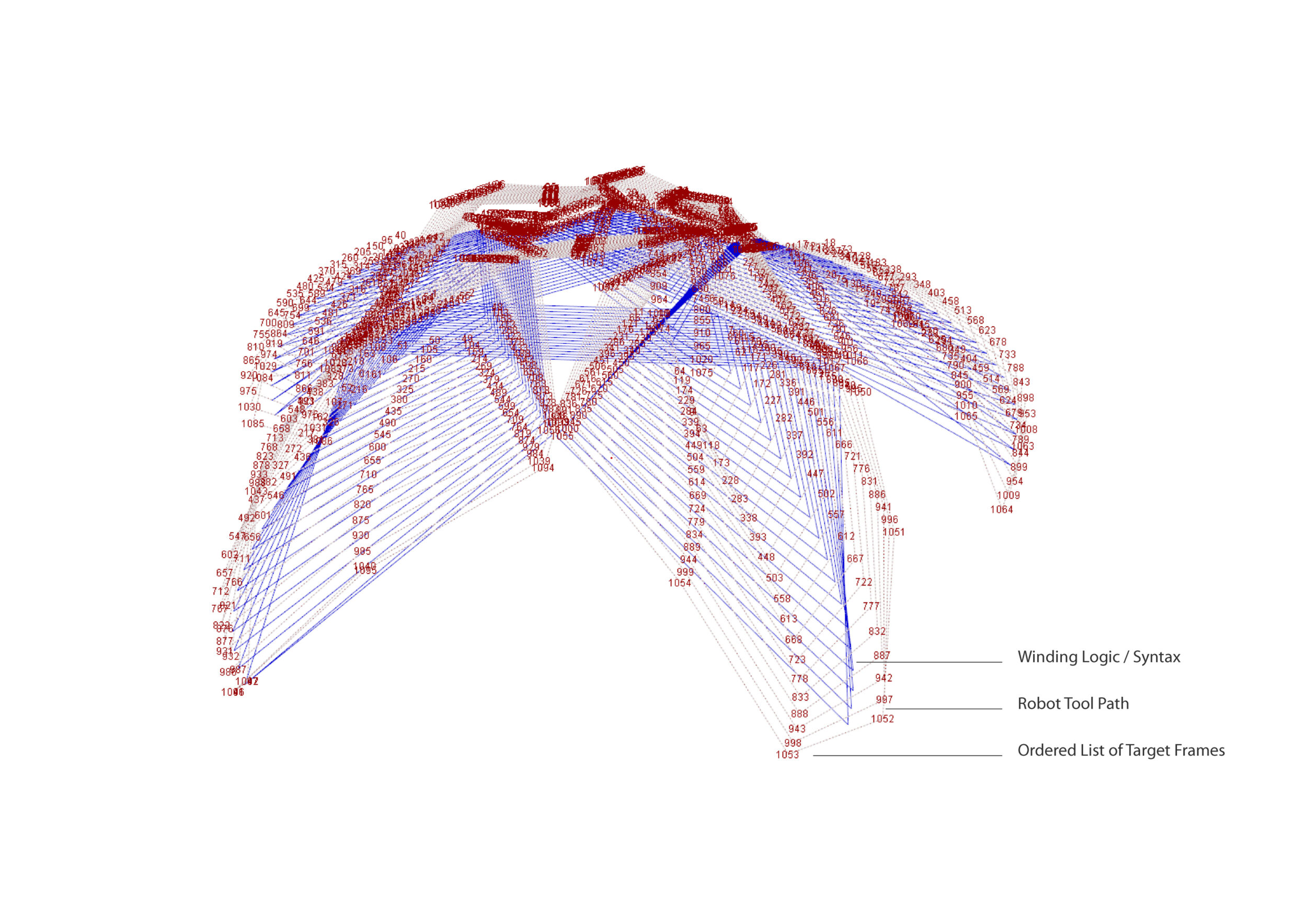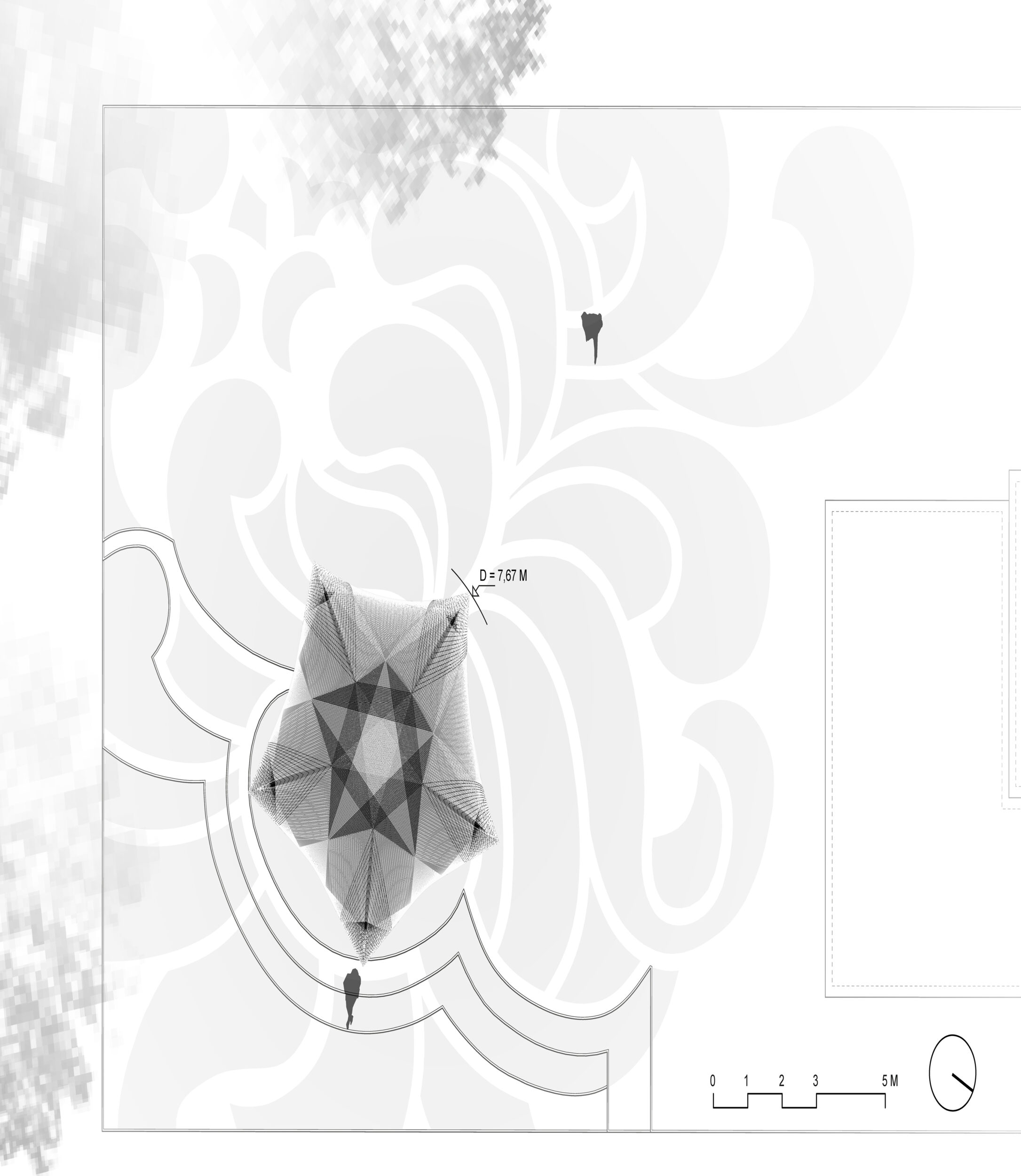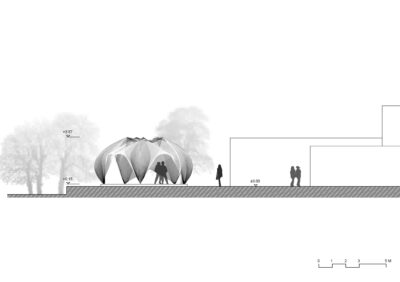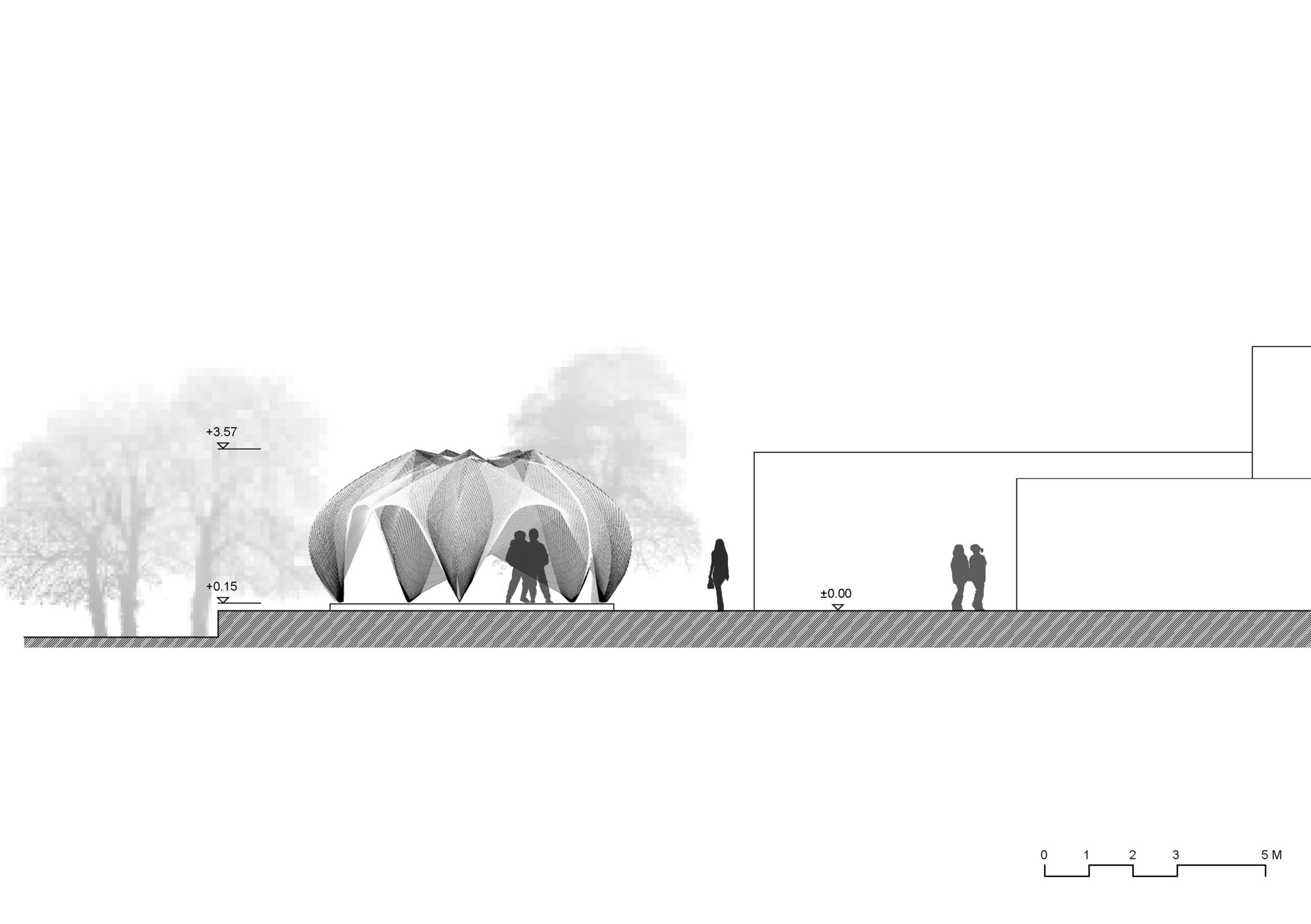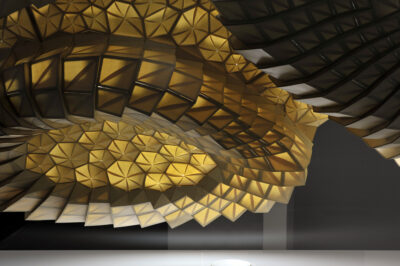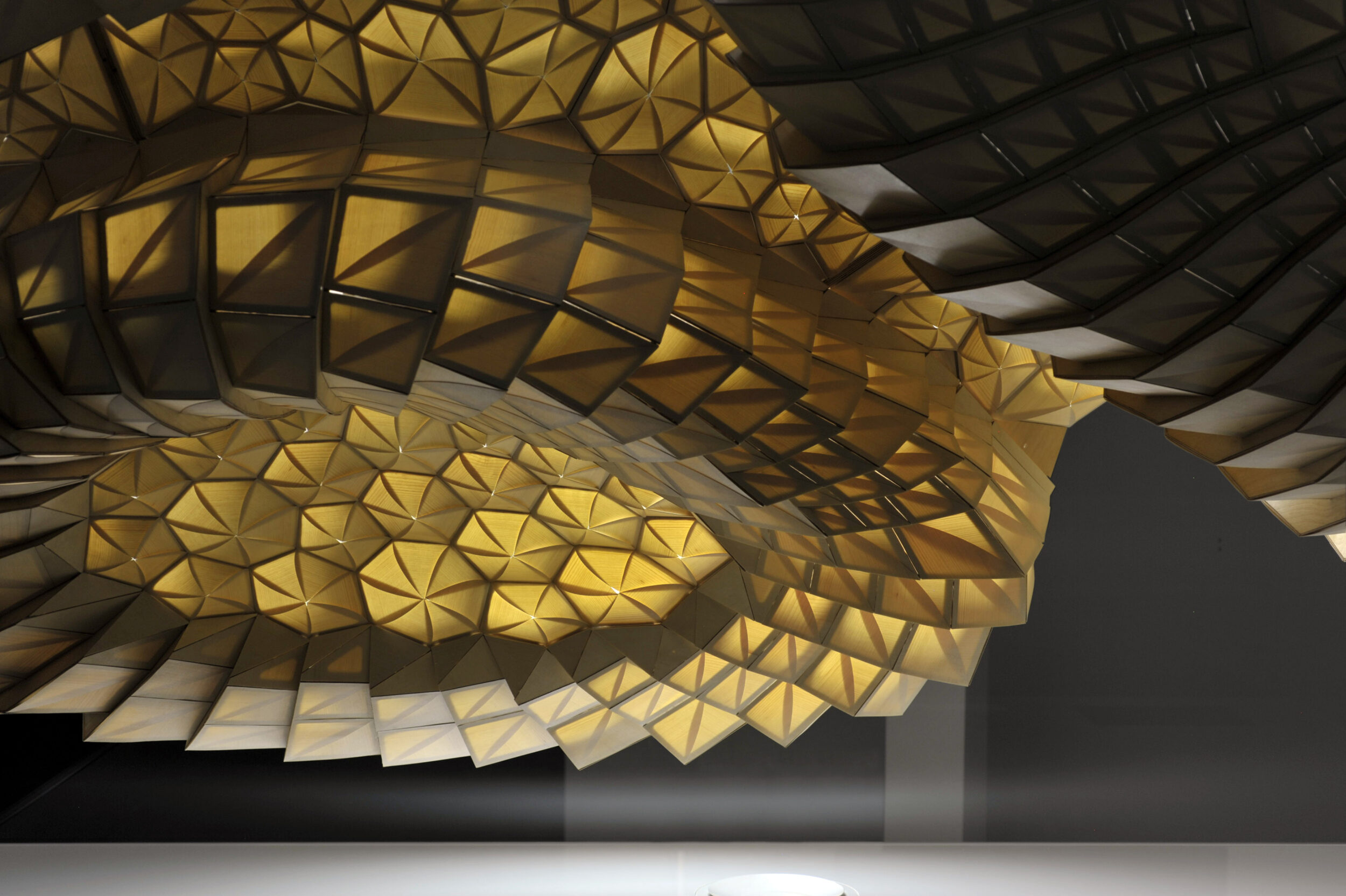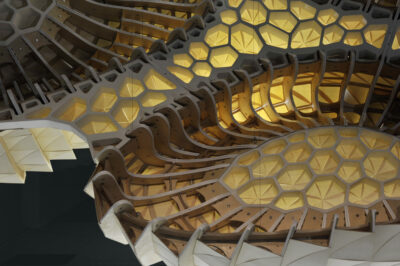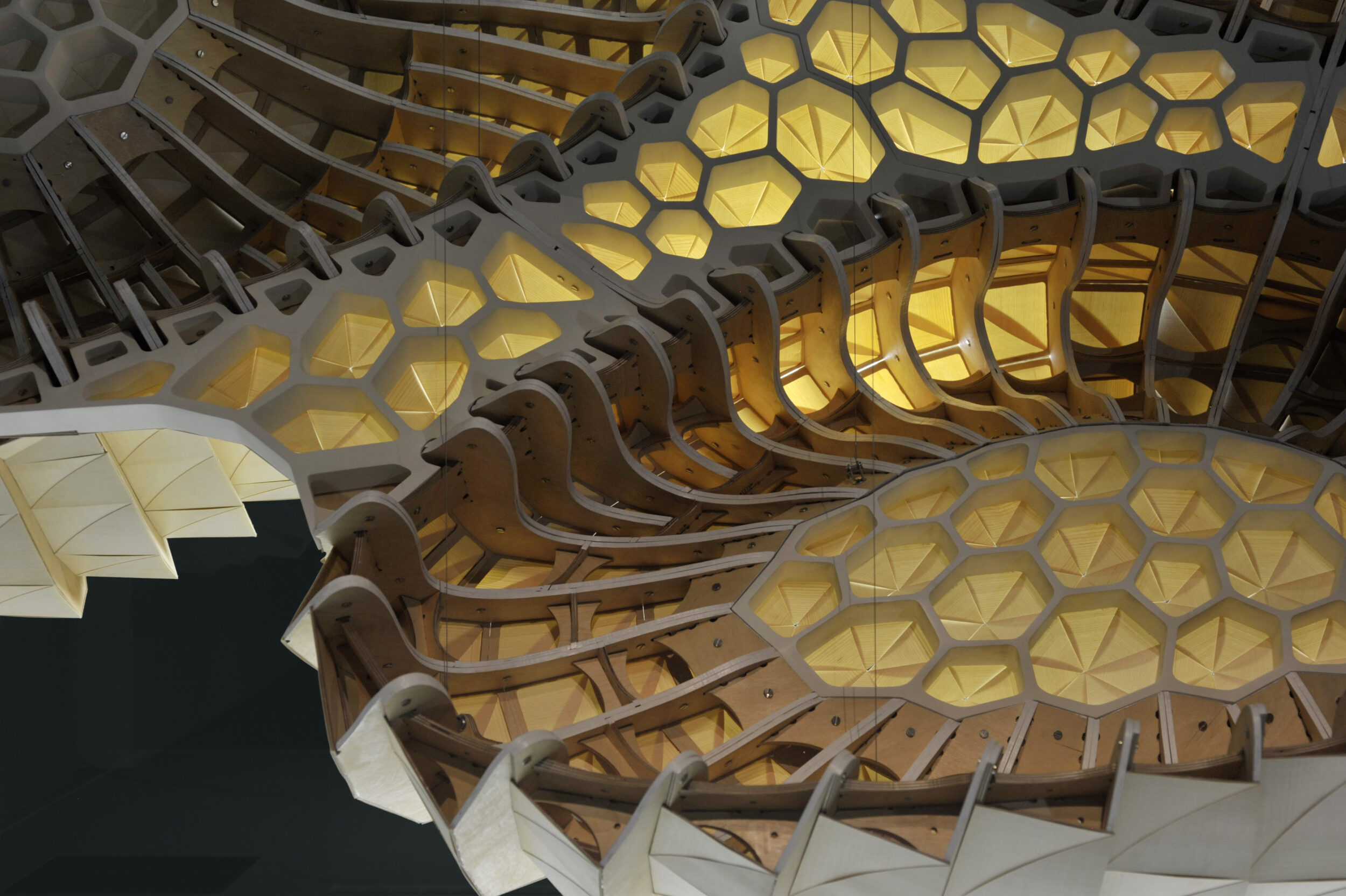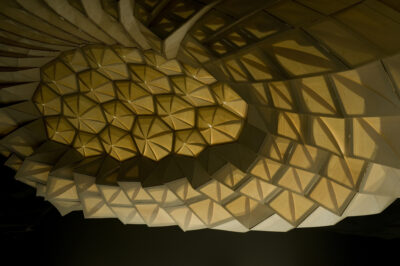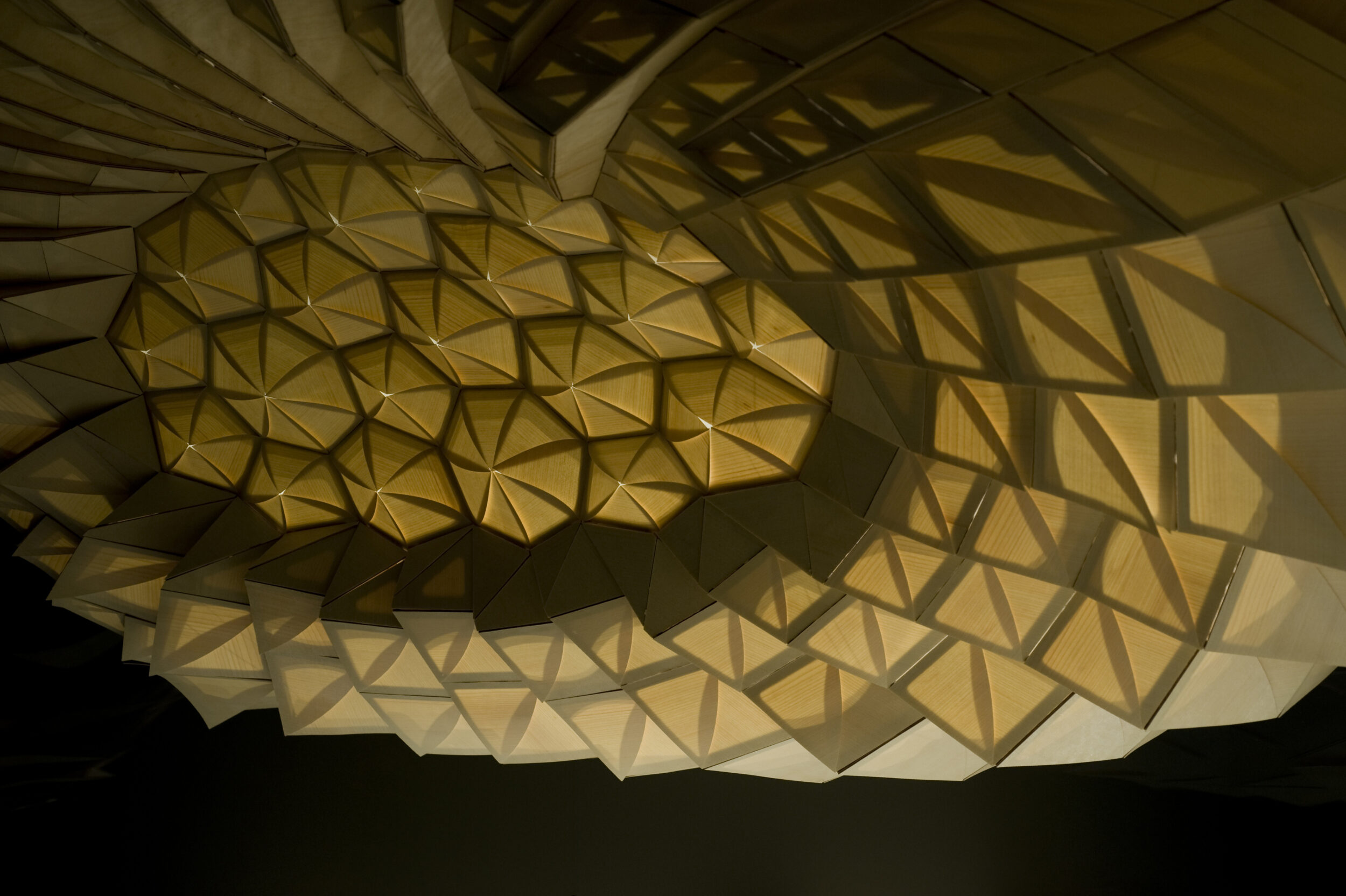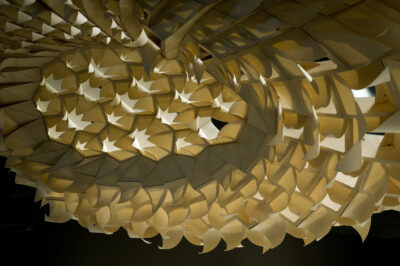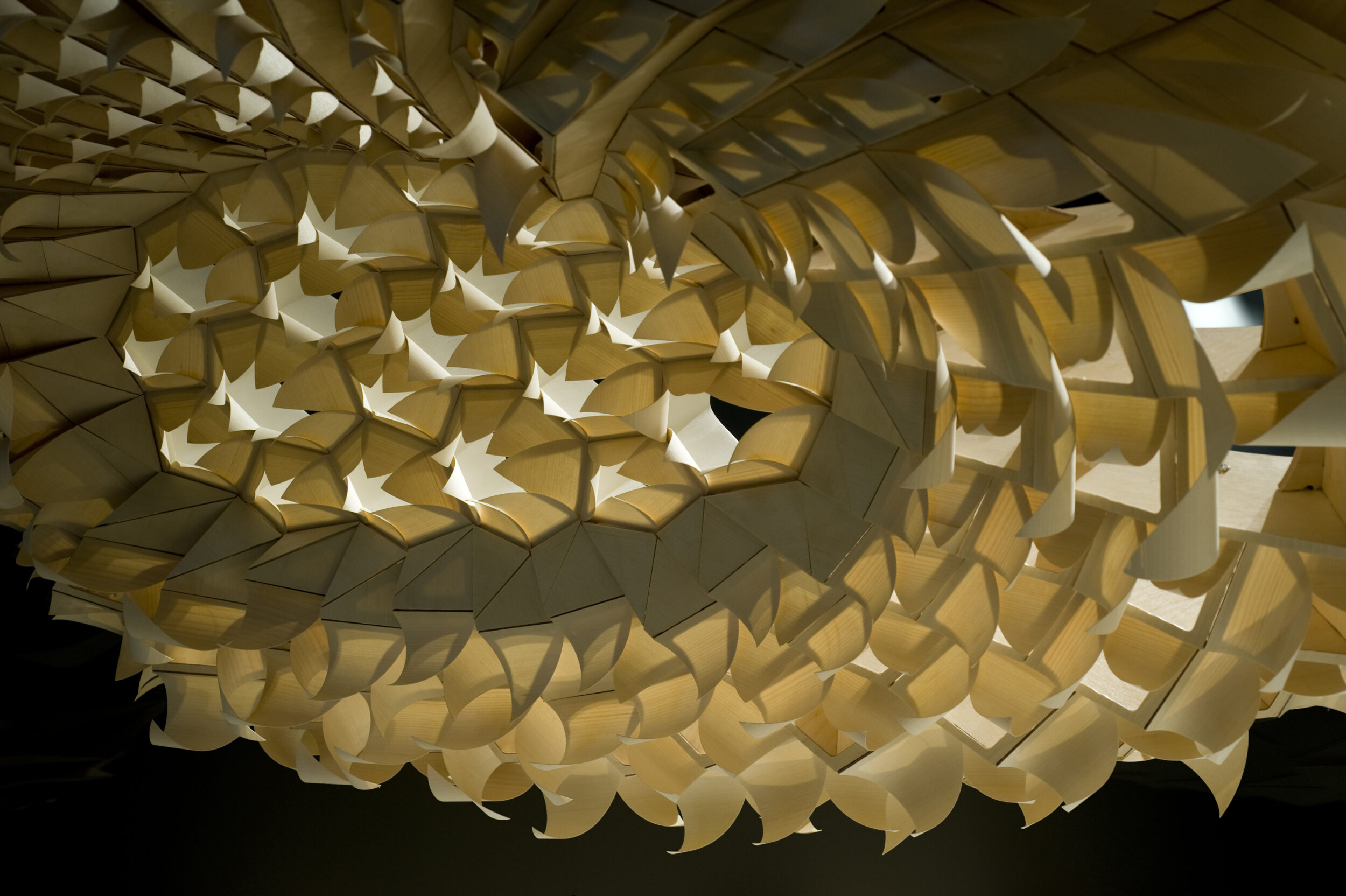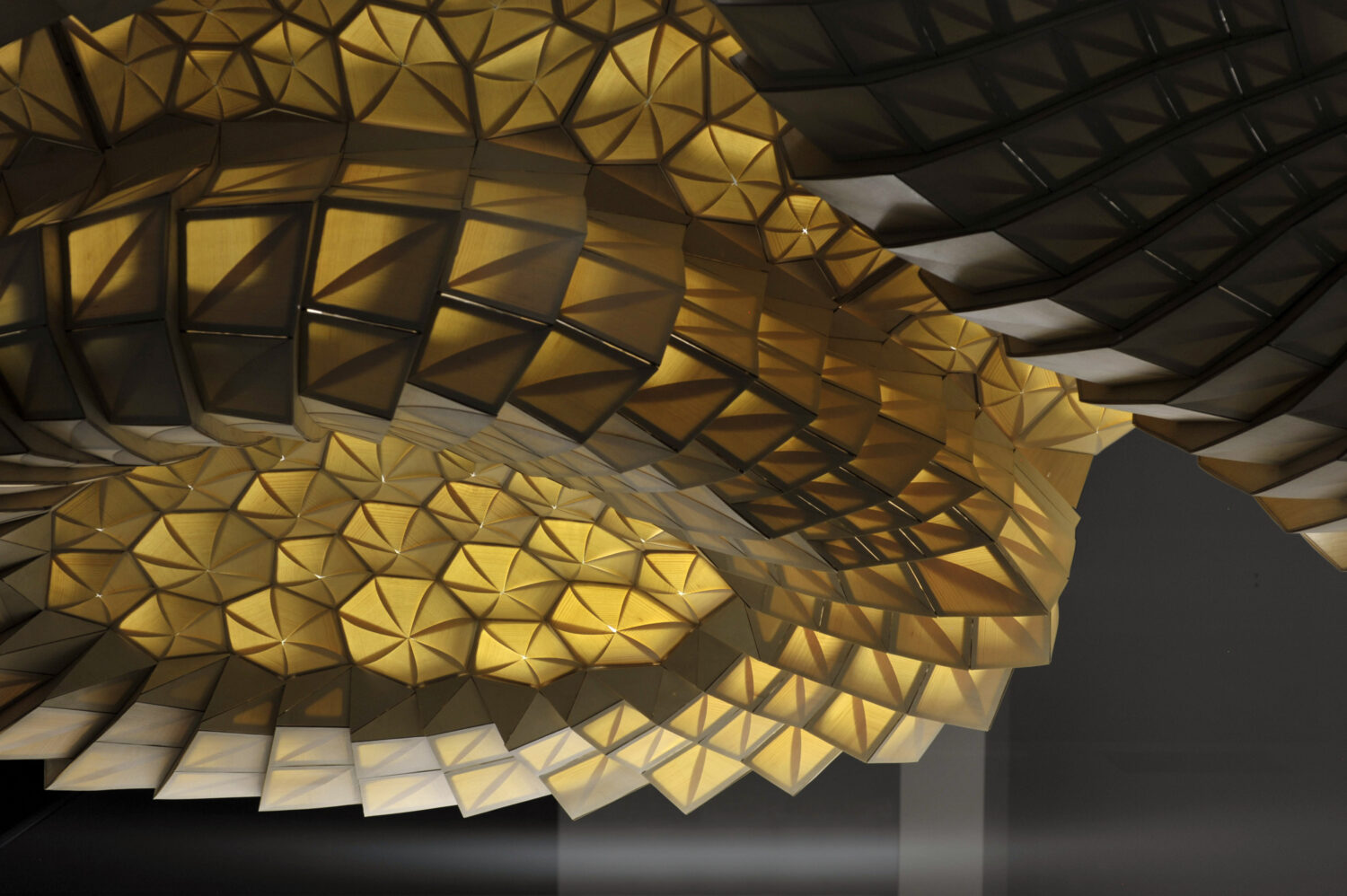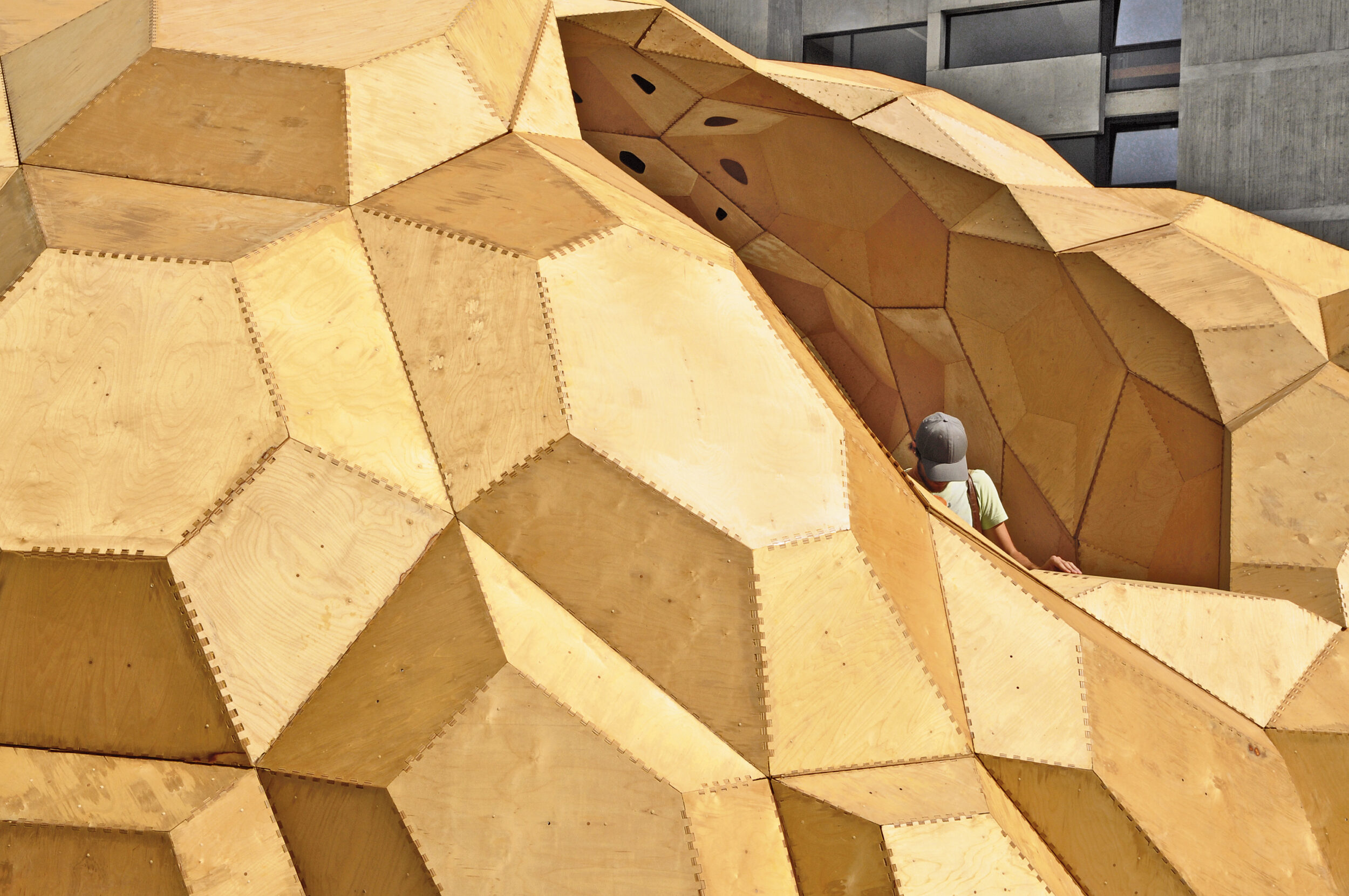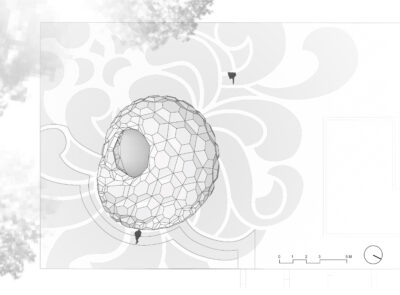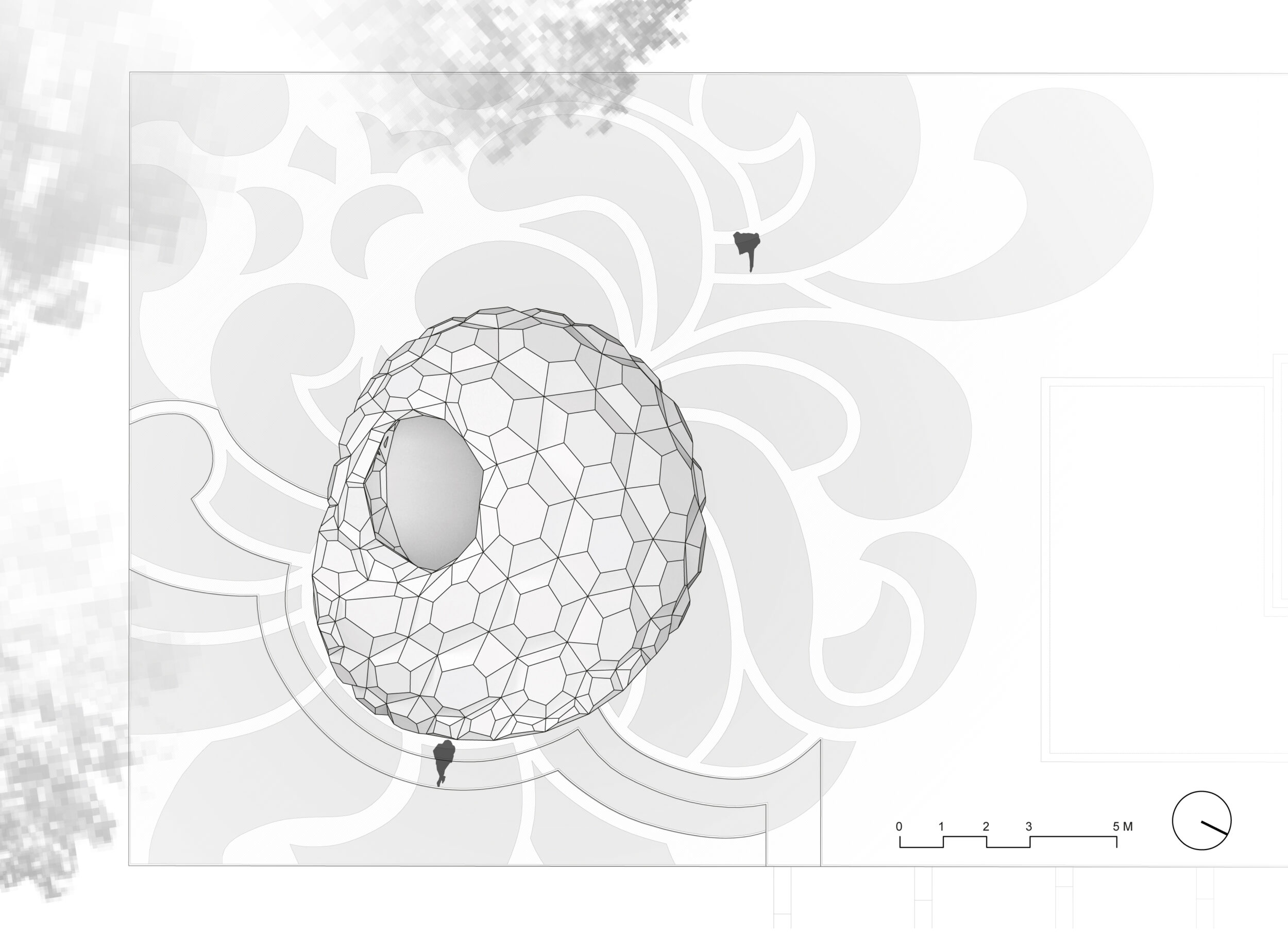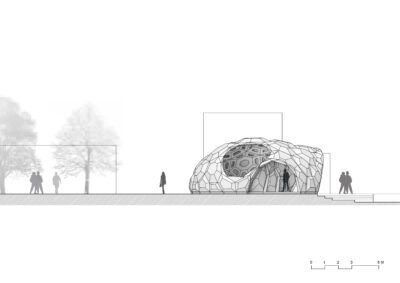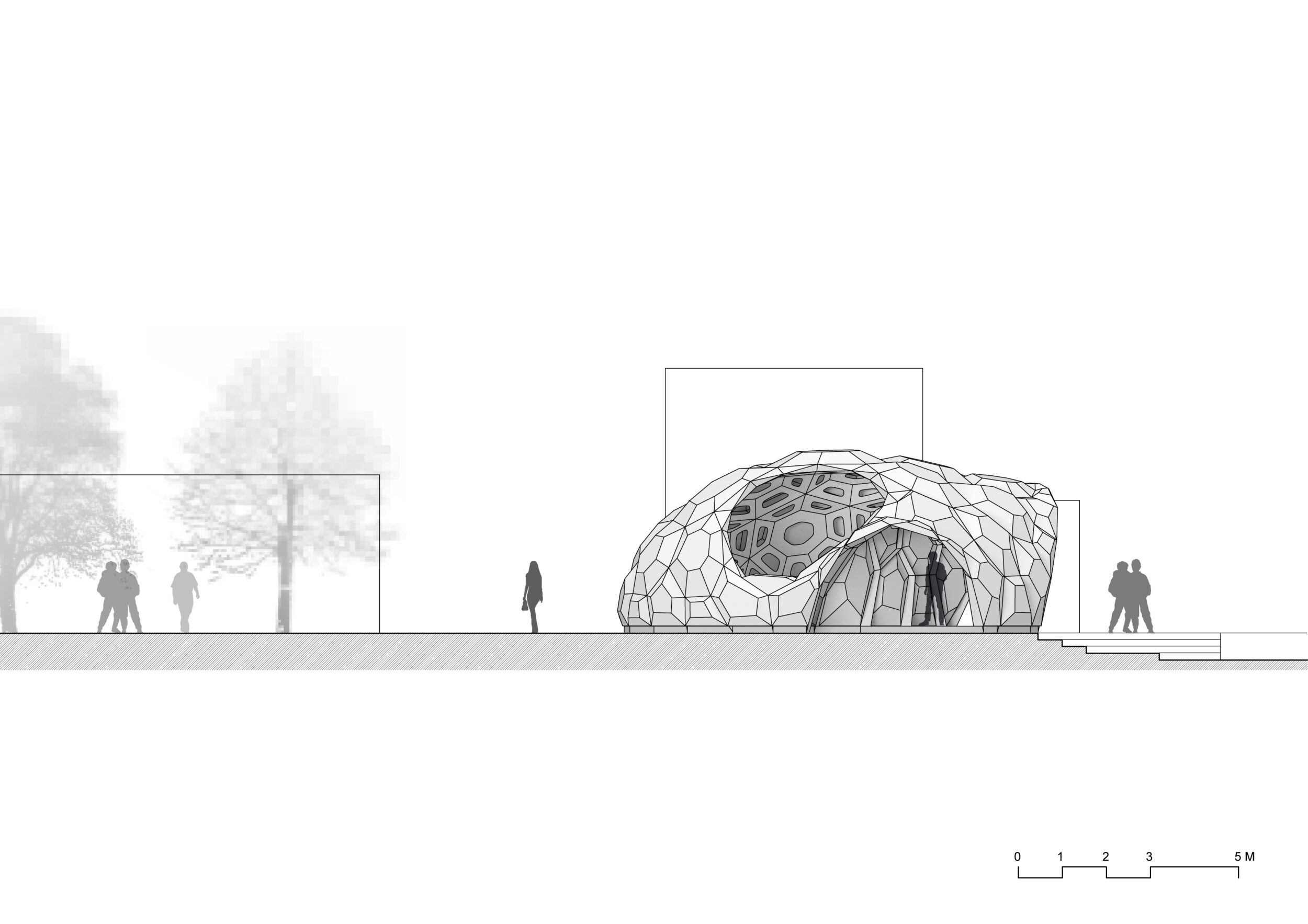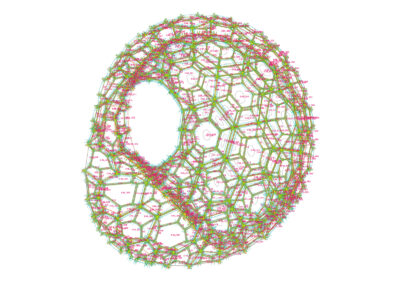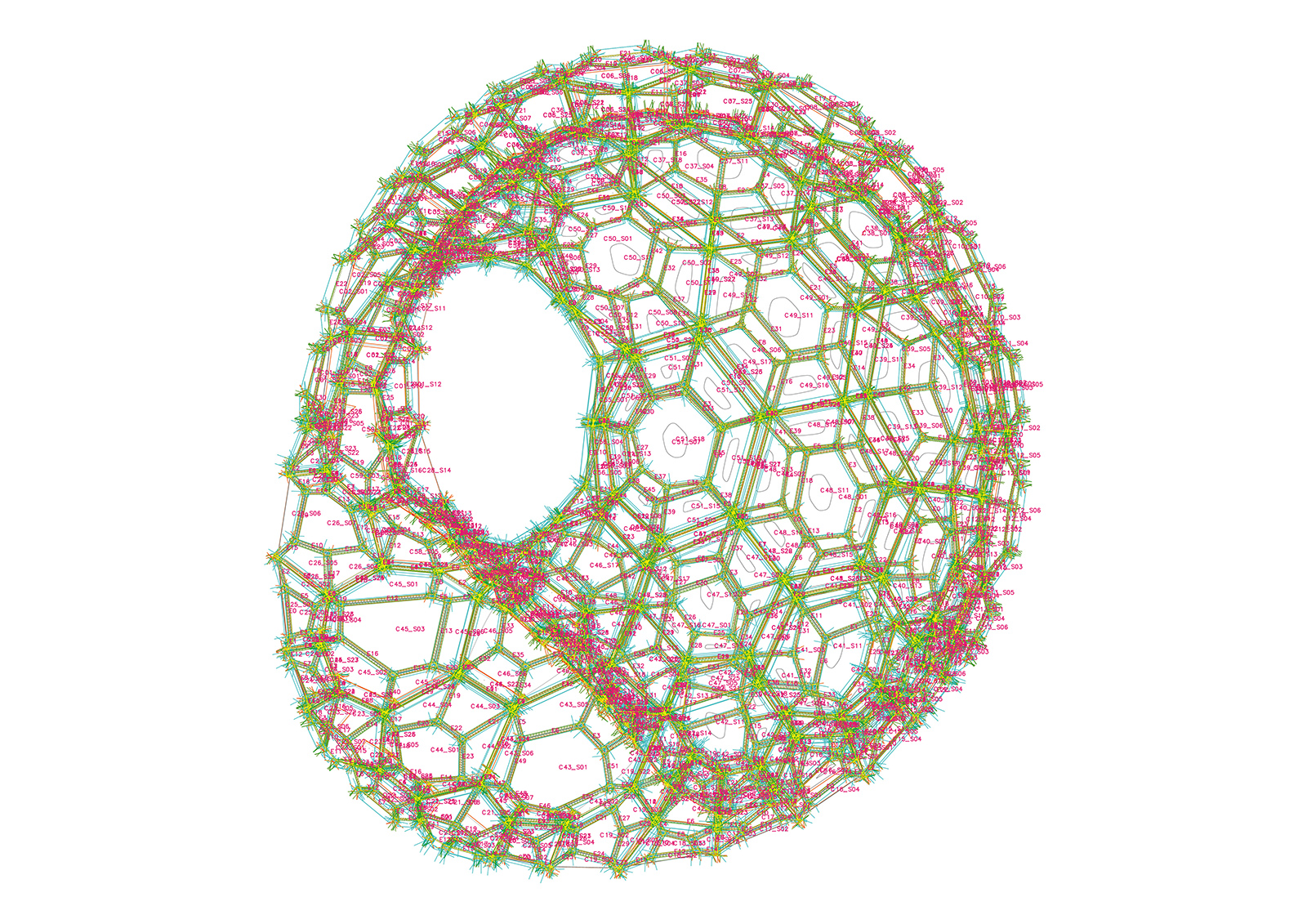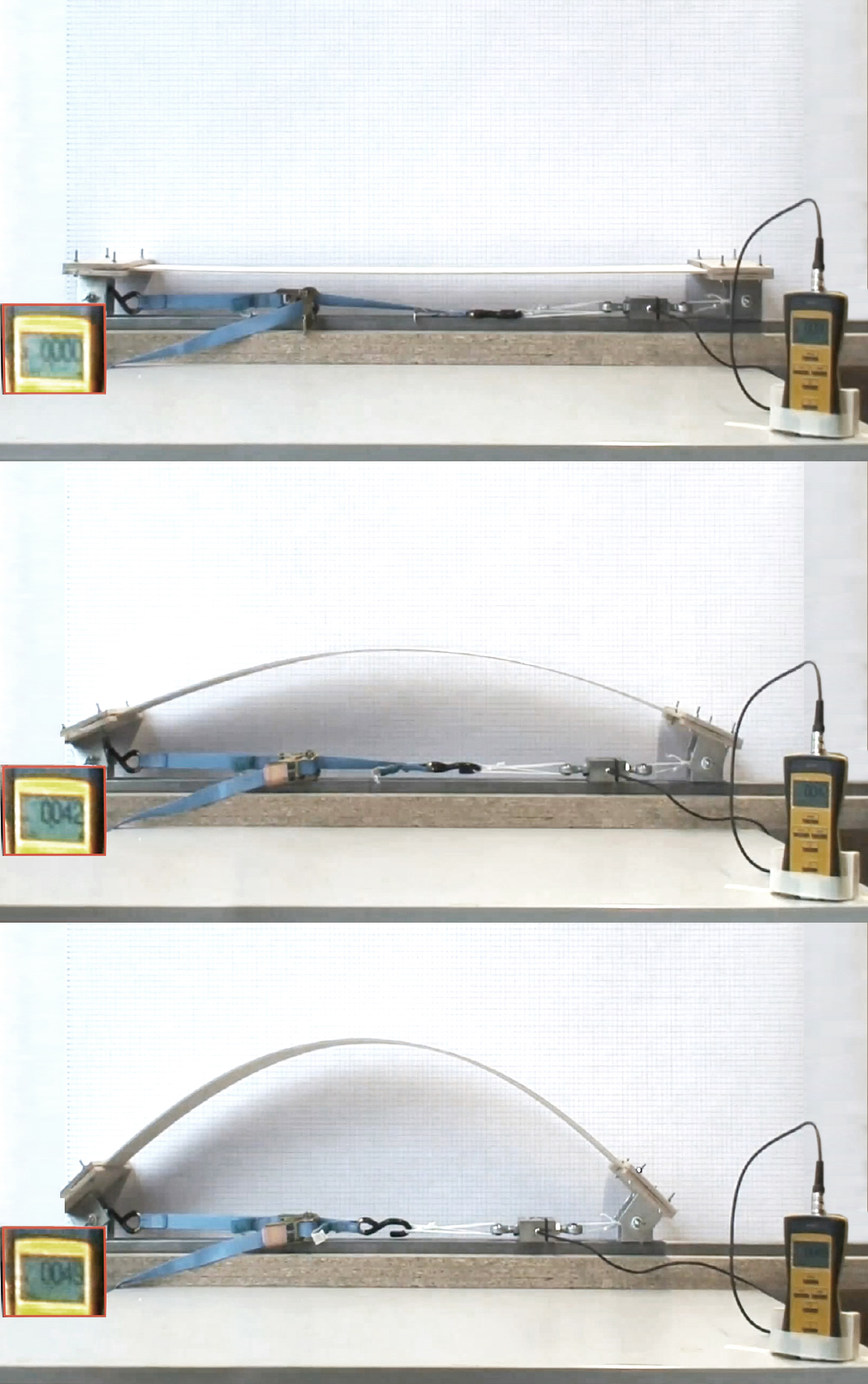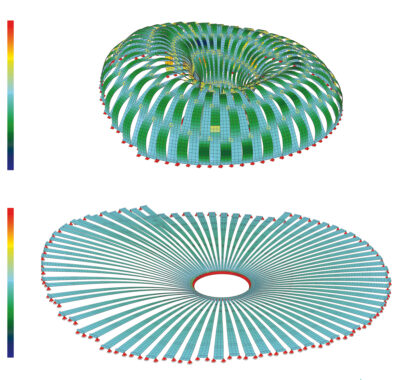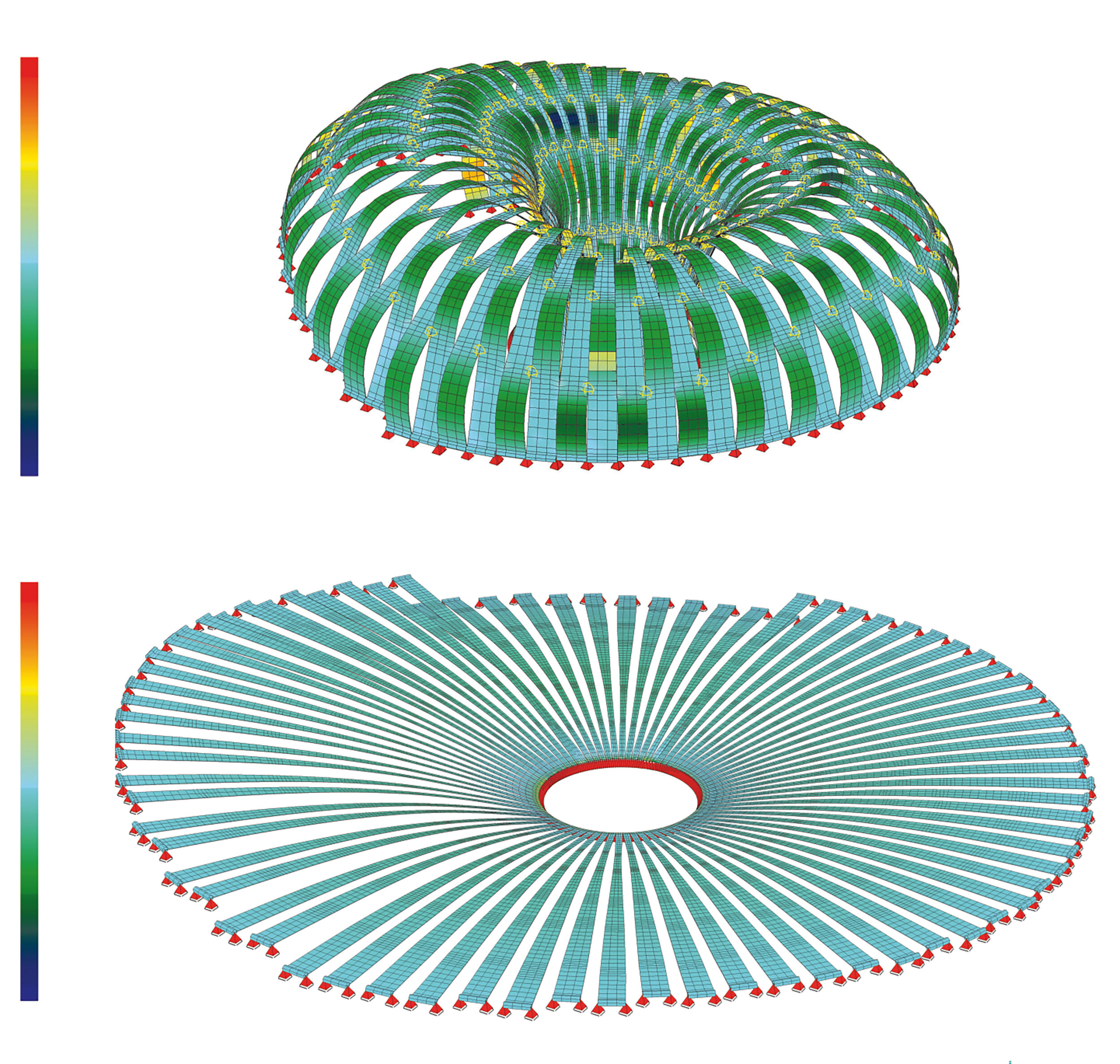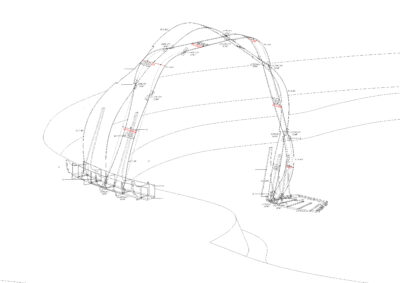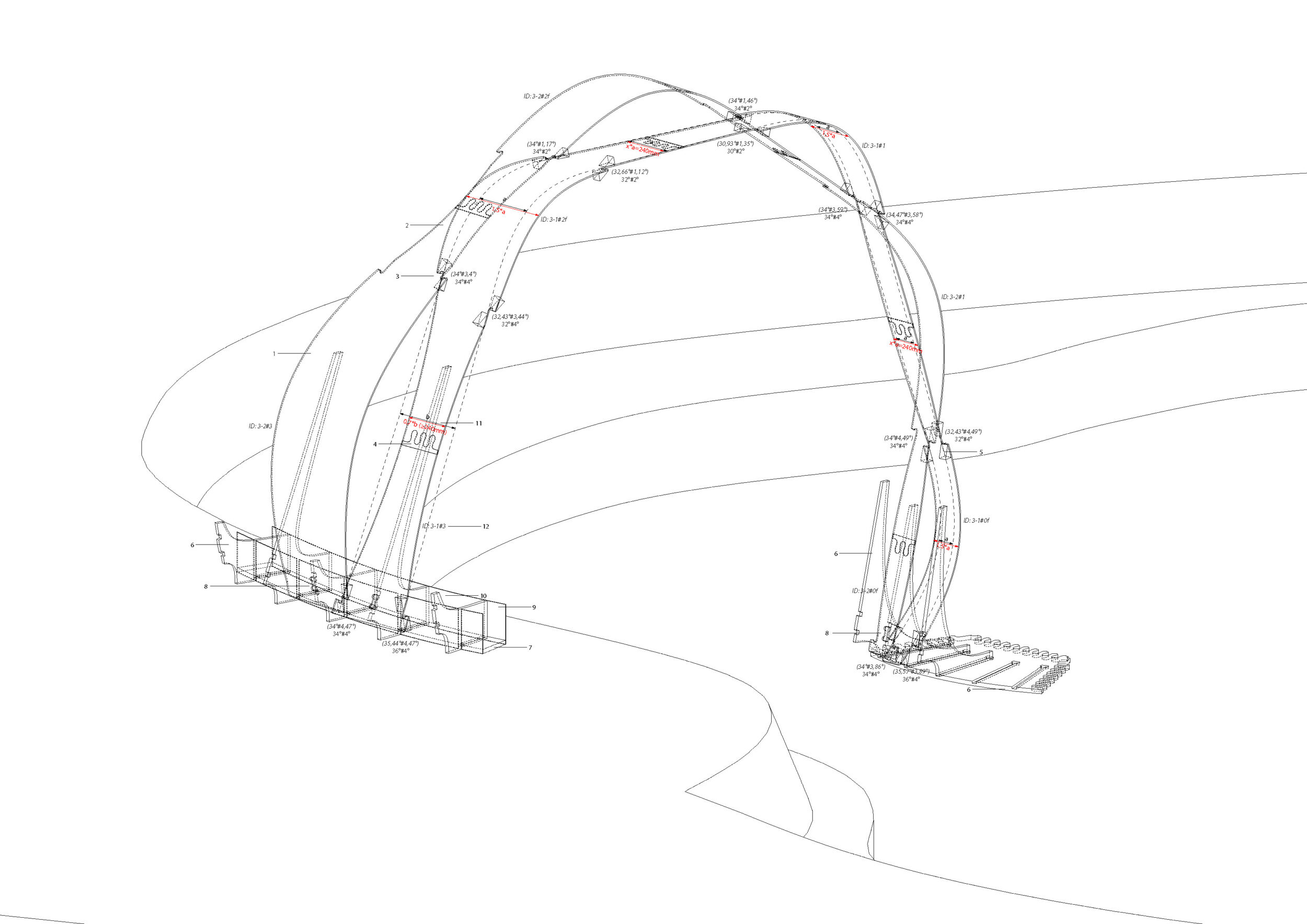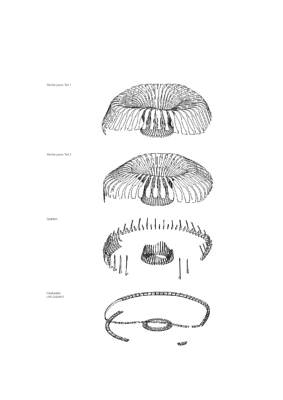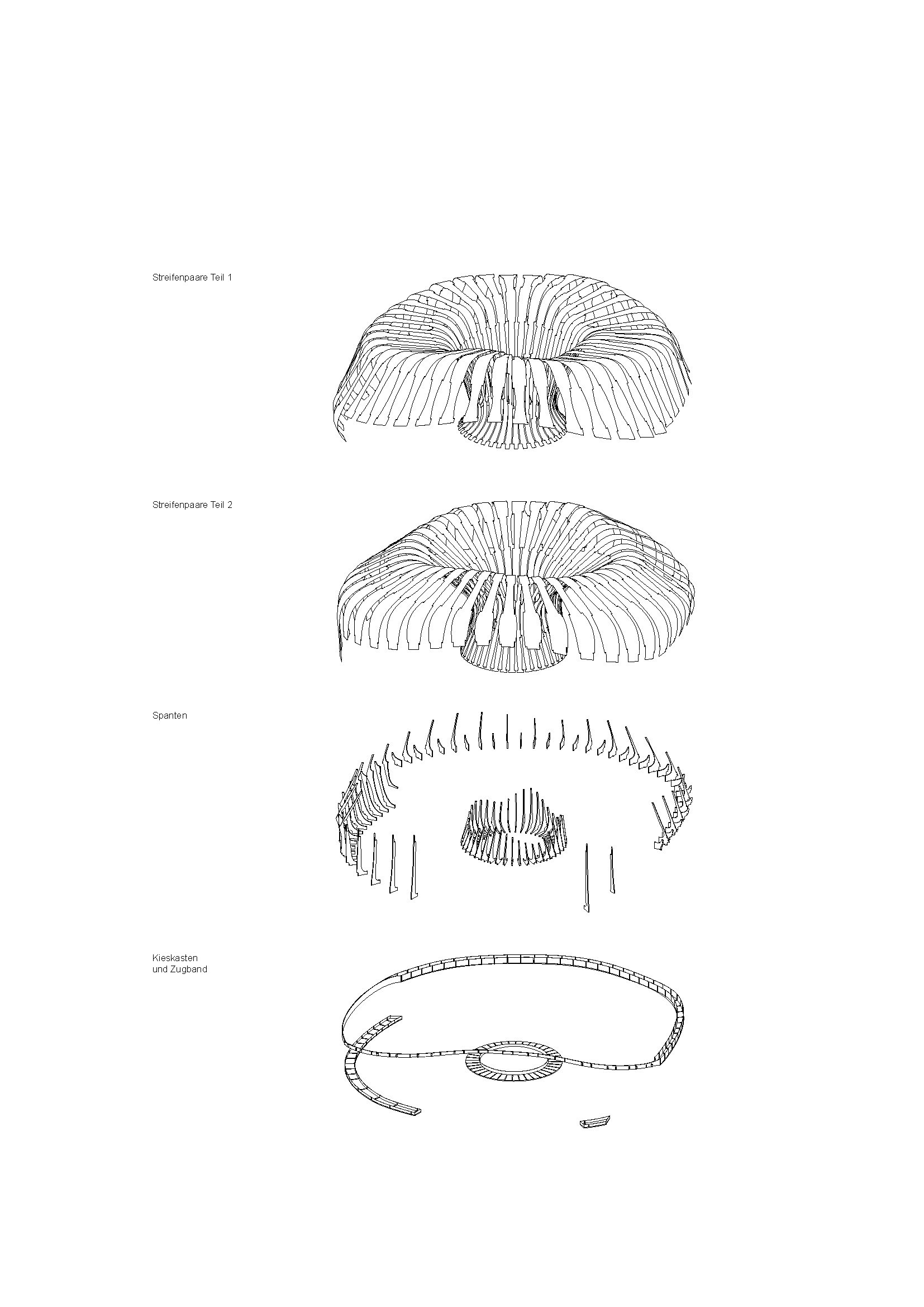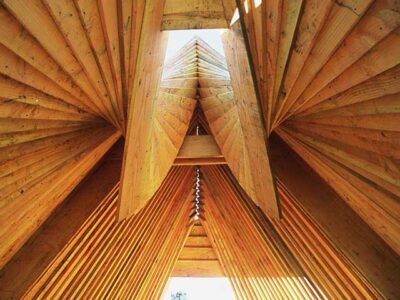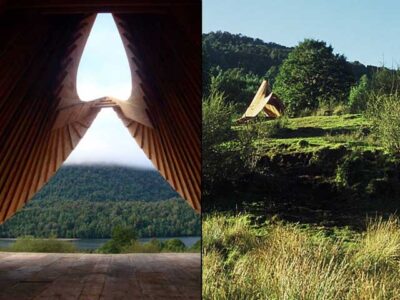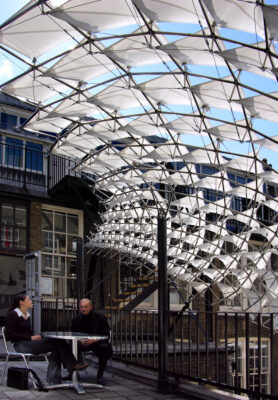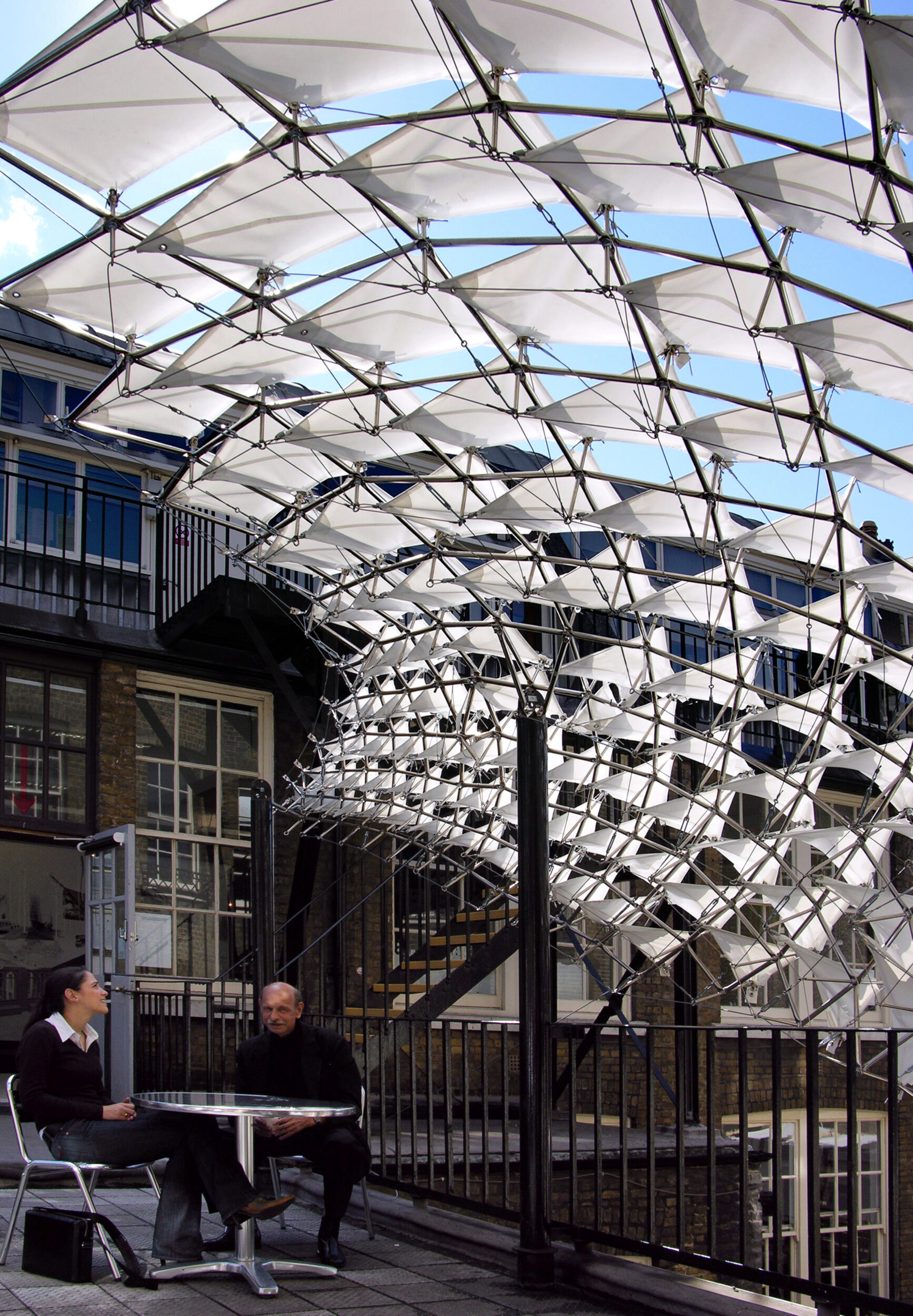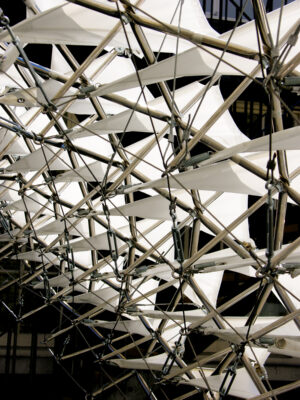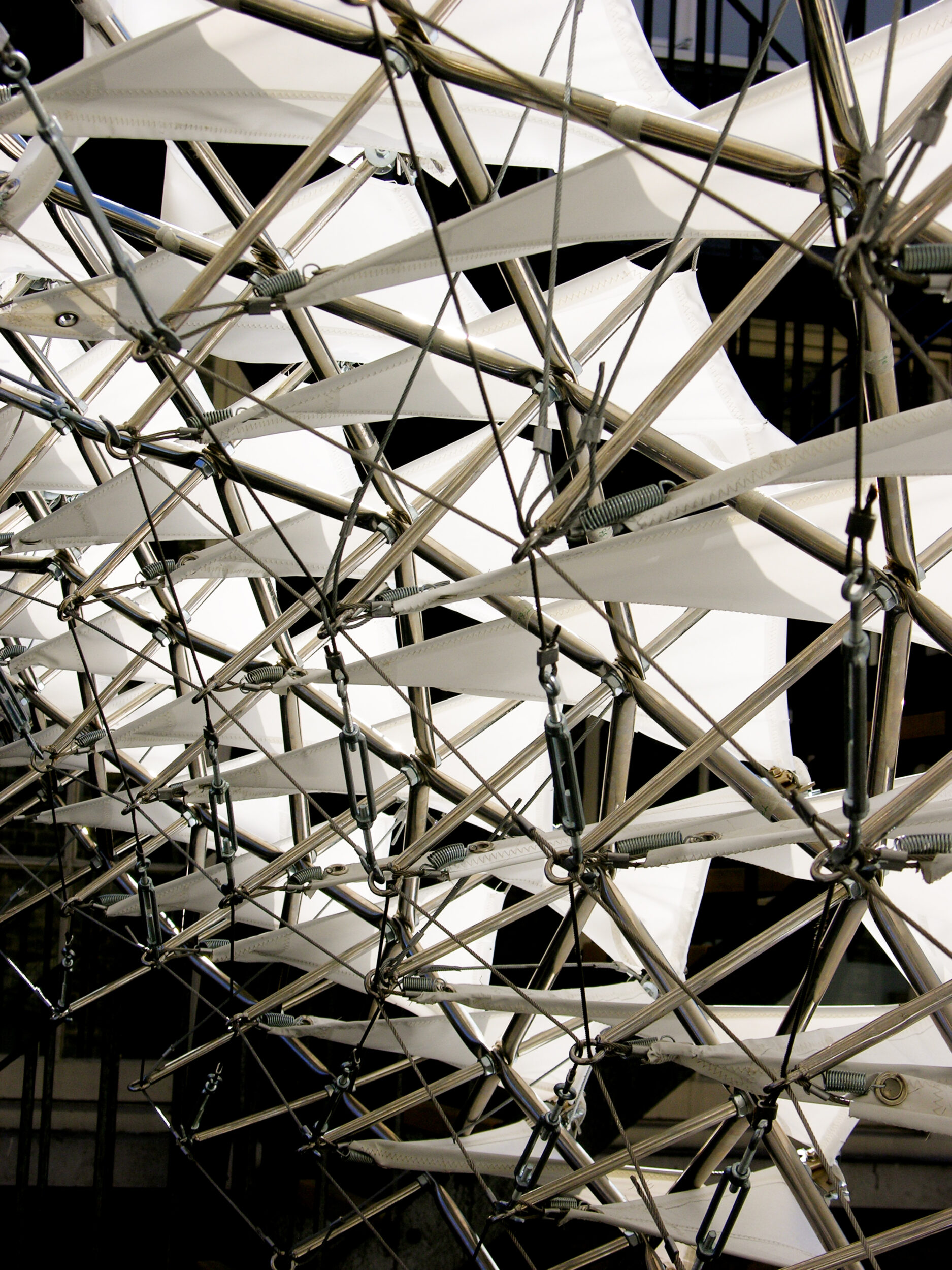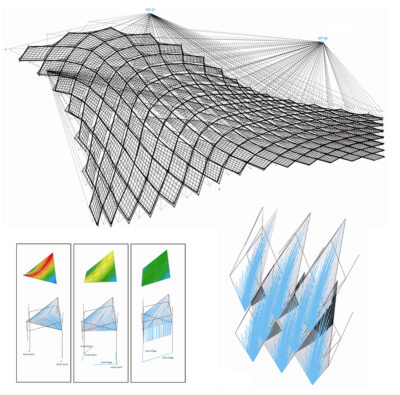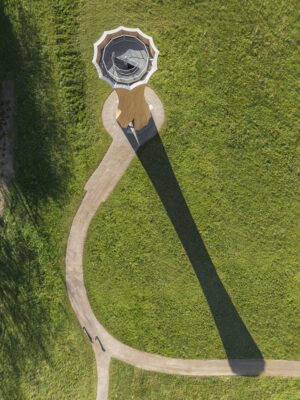














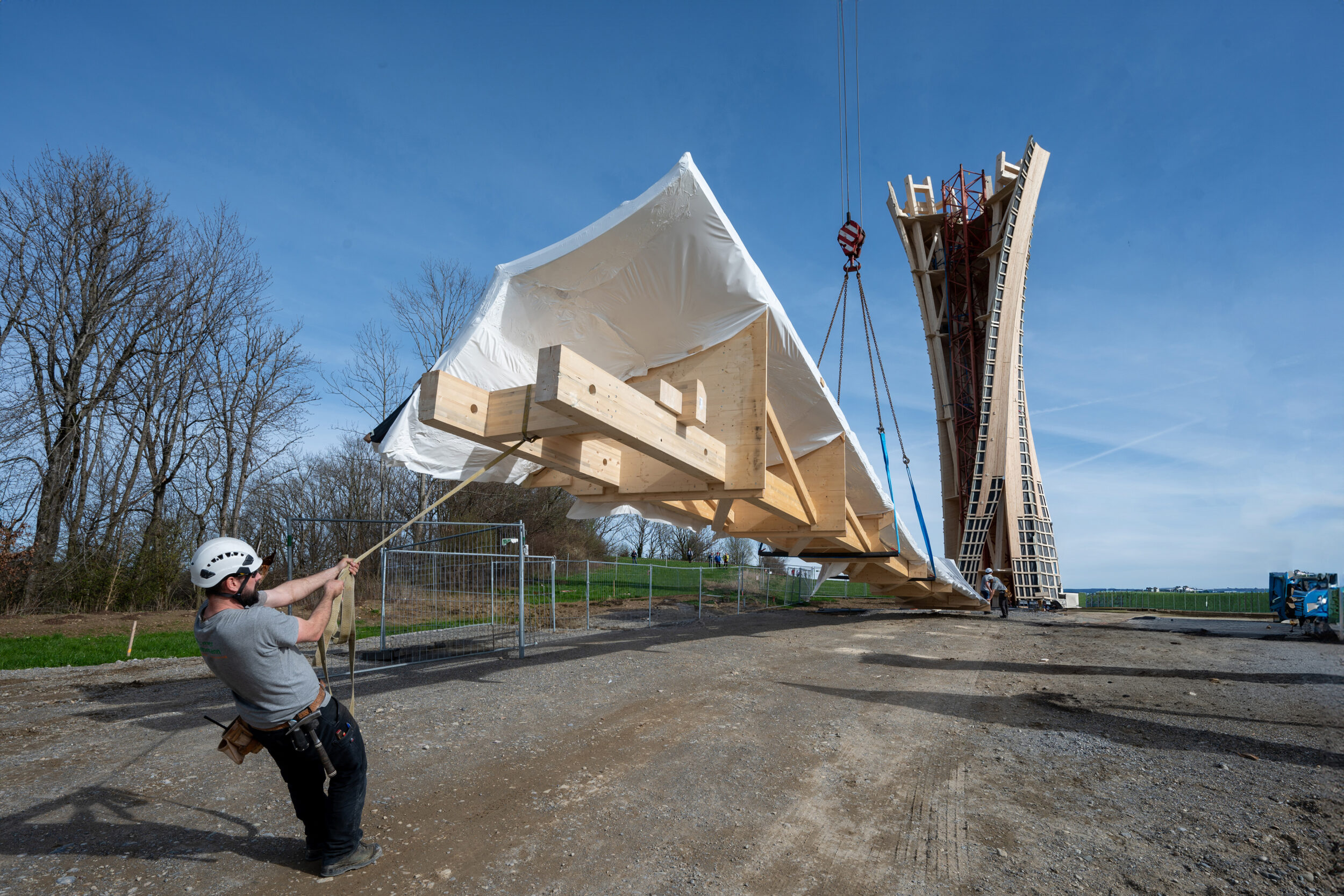

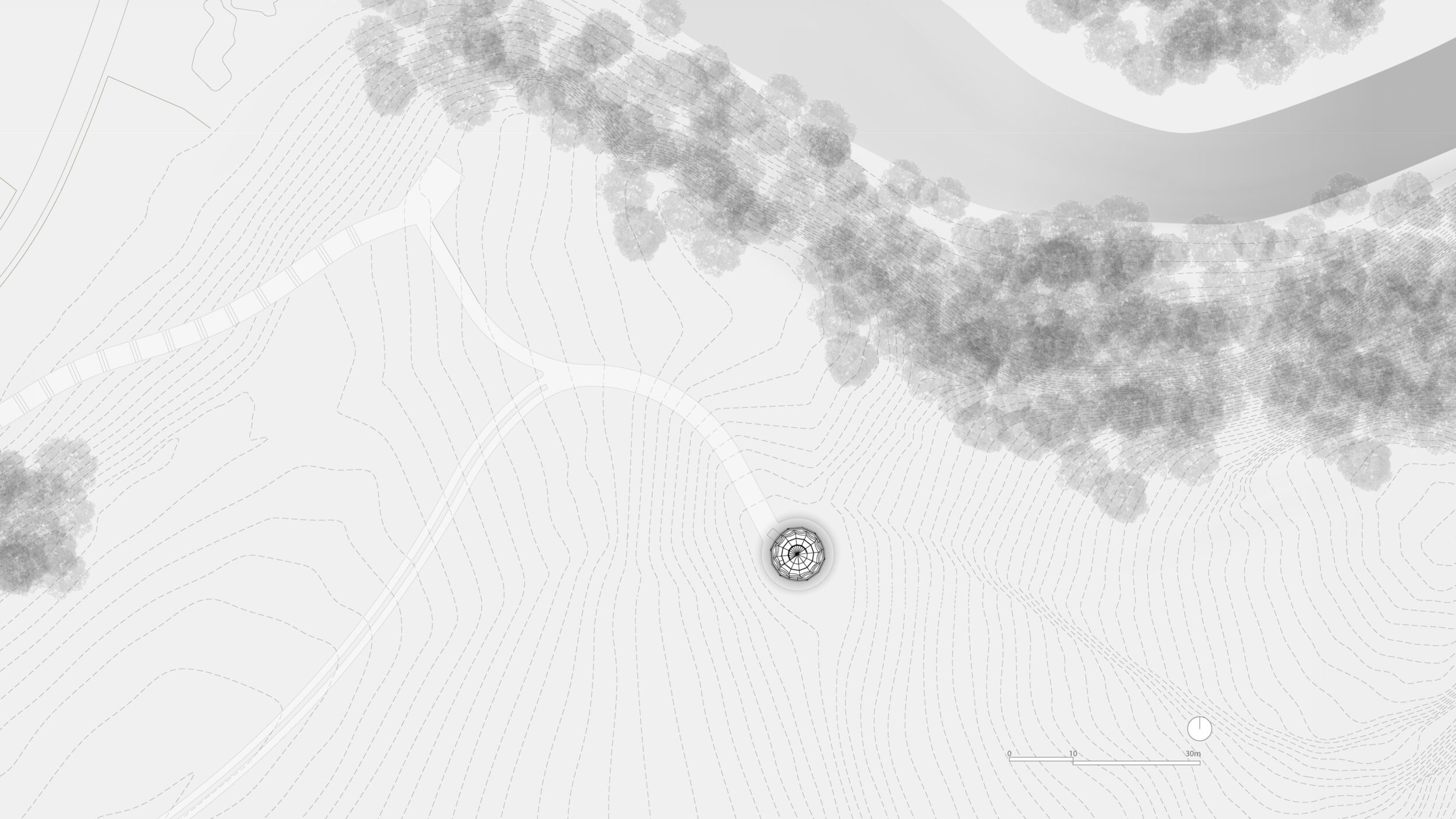
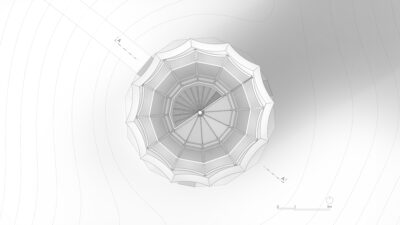
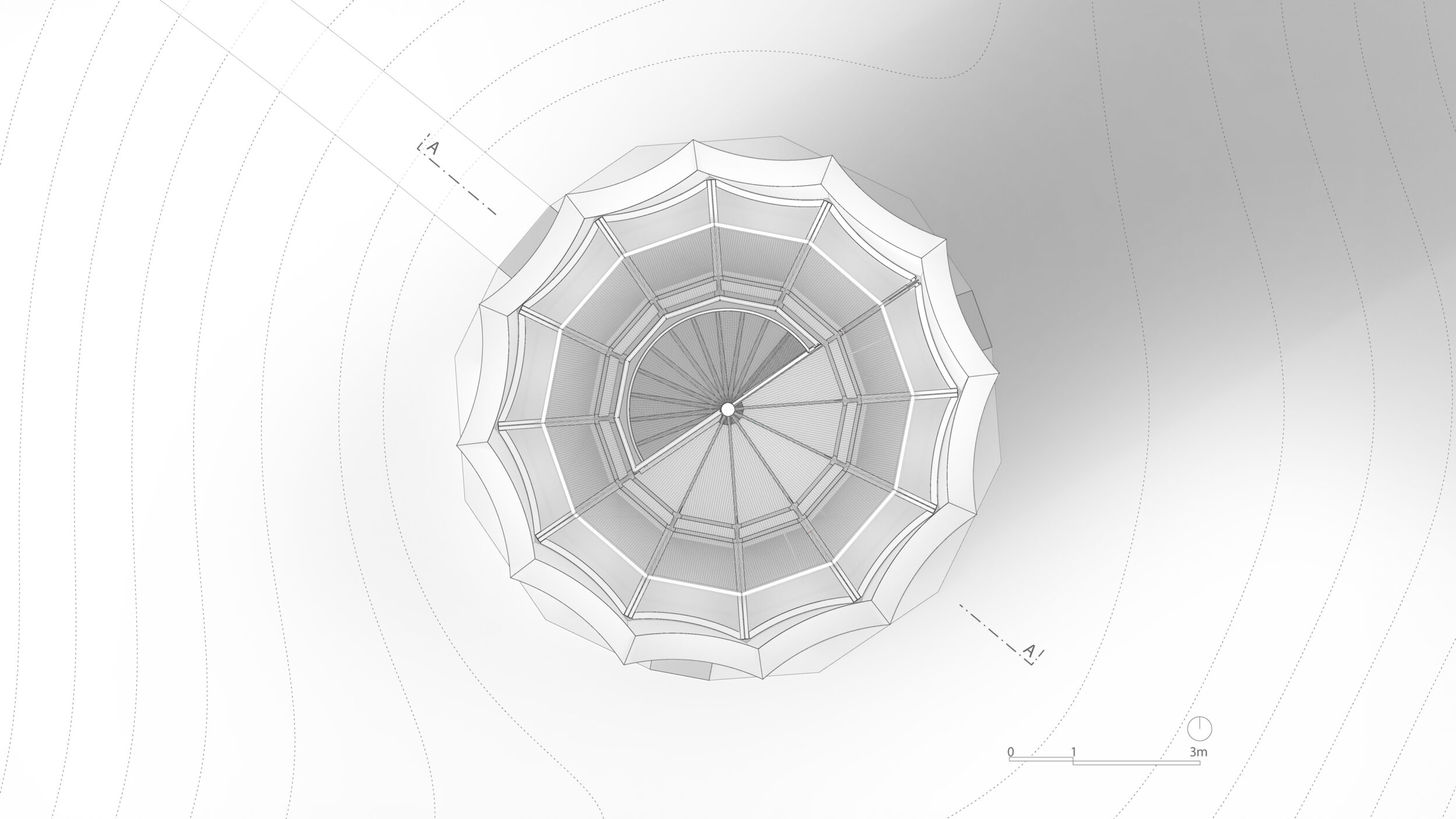
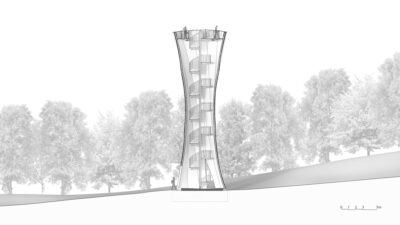
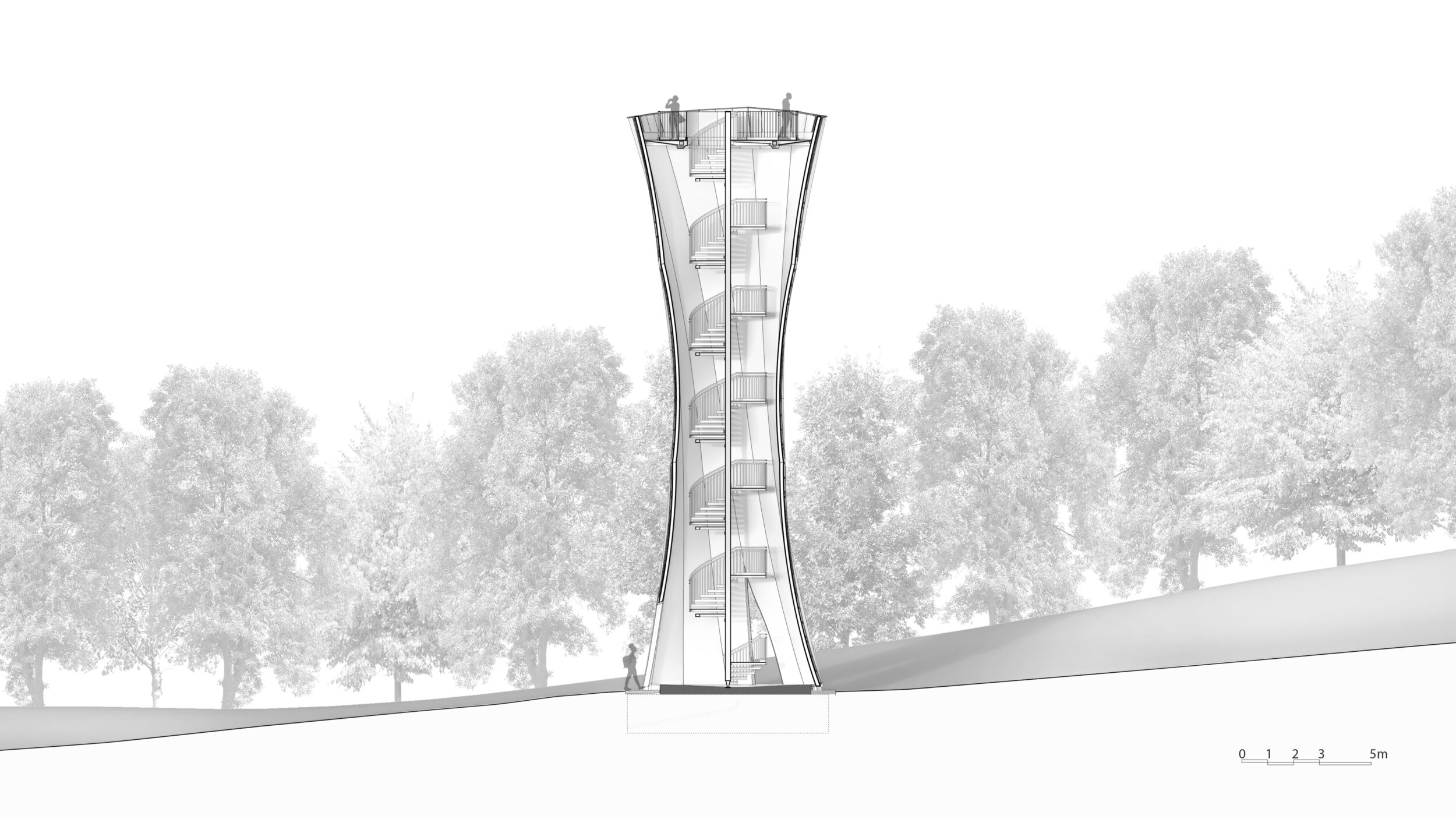




WANGEN TURM
Landesgartenschau in Wangen im Allgäu 2024
| Standort | Wangen im Allgäu |
| Bauherr | Stadt Wangen im Allgäu |
| Fertigstellung | 2024 |
Eingebettet in die eindrucksvolle Landschaft des Westallgäus ist der Wangen Turm ein architektonisches Wahrzeichen und ein wegweisender Holzbau für die Landesgartenschau 2024. Basierend auf der Forschung des Exzellenzclusters »Integratives Computerbasiertes Planen und Bauen für die Architektur (IntCDC)« der Universität Stuttgart ist der Turm die erste in voller Höhe begehbare Struktur, die tragende selbstformende Holzbauteile verwendet. Die charakteristische Form dieses einzigartigen Holzbauwerks ist Ausdruck einer neuen, aus natürlich nachwachsenden, lokal verfügbaren und regional verarbeiteten Materialien bestehenden Architektur. Diese Innovation im Holzbau wird ermöglicht durch die Integration von Forschung, materialgerechter und computerbasierter Planung, digitaler Fertigung und qualifiziertem Handwerk.
Eine ausführliche Projektbeschreibung und mehr Bilder befinden sich hier:
https://www.icd.uni-stuttgart.de/de/projekte/wangen-turm/
______________
PROJEKT TEAM
Exzellenzcluster IntCDC – Integratives Computerbasiertes Planen und Bauen für die Architektur, Universität Stuttgart.
Institut für Computerbasiertes Entwerfen und Baufertigung (ICD)
Prof. Achim Menges, Martin Alvarez, Monika Göbel, Laura Kiesewetter, David Stieler, Dr. Dylan Wood, mit Unterstützung von: Gonzalo Muñoz Guerrero, Alina Turean, Aaron Wagner
Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen (ITKE)
Prof. Jan Knippers, Gregor Neubauer
Blumer-Lehmann AG
Katharina Lehmann, David Riggenbach, Jan Gantenbein
mit Biedenkapp Stahlbau GmbH
Markus Reischmann, Frank Jahr
Stadt Wangen im Allgäu
Landesgartenschau Wangen im Allgäu 2024
WEITERE PROJEKTBETEILIGTE
Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
Professur für Forstnutzung Prof. Dr. Markus Rüggeberg, TU Dresden
Weitere beratende Ingenieure:
wbm Beratende Ingenieure
Dipl.-Ing. Dietmar Weber, Dipl.-Ing. (FH) Daniel Boneberg
Collins+Knieps Vermessungsingenieure
Frank Collins
Schöne Neue Welt Ingenieure GbR
Florian Scheible, Andreas Otto
lohrer.hochrein Landschaftsarchitekten DBLA
Baugenehmigung:
Prüfingenieur: Prof. Hans Joachim Blaß, Karlsruhe
Gutachter: MPA Stuttgart, Dr. Gerhard Dill Langer, Prof. Dr. Philipp Grönquist
Zusammenarbeit für Fundament:
Fischbach Bauunternehmen
PROJEKTFÖRDERUNG
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
Zukunft Bau – Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen/BBSR